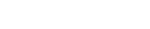Seit 2020 hat sich die Zahl der Klimaklagen vervierfacht – insgesamt stieg sie nach Angaben von US-Forschern Ende 2023 weltweit auf 2.500 an. Einzelpersonen klagen gegen Regierungen, die in ihren Augen viel zu wenig für den Klimaschutz tun – und gegen Unternehmen, die zu viel CO2 ausstoßen.
Besonders ein Fall sorgt international für Aufsehen: Ein Kleinbauer aus Peru kämpft seit rund zehn Jahren dafür, den Energiekonzern RWE für Klimaschäden in seiner Heimat zur Verantwortung zu ziehen. Ein Urteil wird am 28. Mai 2025 erwartet.
Doch nur ein Bruchteil der Klagen landet tatsächlich vor Gericht. Entsprechend gibt es bisher wenig etablierte Rechtsprechung zum Klimawandel. Häufig werden die Verfahren von Umweltschutzorganisationen initiiert und unterstützt. Wir stellen einige Beispiele vor.
2015 hatte der peruanische Bauer Saúl Luciano Lliuya eine Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE am Landgericht Essen eingereicht, weil das Schmelzwasser eines Gletschers sein Dorf und sein Haus bedroht. Das Verfahren hatte weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Bis dahin hatte noch nie ein einzelner Mensch in einem zivilrechtlichen Verfahren einen Konzern wegen des Klimawandels vor Gericht gebracht. Lliuya wird dabei von der Umweltorganisation Germanwatch und der Stiftung Zukunftsfähigkeit unterstützt.
Lliuya verlangt, dass der Essener Konzern anteilig die Kosten der Schutzmaßnahmen übernimmt, die für sein Haus und Dorf wegen des Klimawandels notwendig geworden sind. Da RWE nach Studien etwa 0,5 Prozent des menschengemachten Klimawandels verursacht hat, fordert Lliuya eine Übernahme von 0,47 Prozent der Kosten. Demnach müsse sich der Konzern mit rund 17.000 Euro (18.520 Dollar) an den Schutzmaßnahmen beteiligen, die insgeamt 3,5 Millionen Dollar kosten.
In Essen wurde die Klage in erster Instanz zwar abgewiesen. Im November 2017 hatte das Oberlandesgericht Hamm dann völlig überraschend die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ein deutsches Unternehmen für die Folgen des Klimawandels in anderen Gegenden der Erde haften muss, und gab dem Kläger in zweiter Instanz Recht.
Das Gericht ordnete eine Beweisaufnahme in Peru an. Sachverständige reisten gemeinsam mit Richtern und Anwälten nach Peru, um zu überprüfen, ob das Haus von Lliuya tatsächlich vor einer möglichen Flutwelle des oberhalb der Stadt liegenden Gletschersees Palcacocha bedroht ist. Bereits am 5. Februar 2019 war eine Eislawine in den Gletschersee gestürzt und hatte meterhohe Wellen ausgelöst.
Urteil soll am 28. Mai fallen
Nach einigen Verzögerungen hatten zwei Sachverständige Mitte März 2025 ihr Gutachten in einer mündlichen Verhandlung vor dem OLG vorgestellt und Fragen beantwortet. Sie gehen nicht davon aus, dass in den nächsten 30 Jahren eine ernsthafte Beeinträchtigung des Hausgrundstücks des Klägers durch eine Überflutung oder eine Schlammlawine droht.
Der Termin, an dem das Gericht sein Urteil bekannt geben wollte (Verkündungstermin), war zuerst für den 14. April geplant. Weil der Kläger Lliuya einen Gutachter unter anderem für befangen hielt, wurde der Termin auf den 28. Mai verschoben. Das OLG wies den Befangenheitsantrag Mitte Mai zurück.
Der Fall hat laut Germanwatch eine Signalwirkung entfaltet wie keine andere Klimaklage: „Es handelt sich um die weltweit einzige Klage auf unternehmerische Haftung für Klimarisiken, die es in die Beweisaufnahme geschafft und damit bereits Rechtsgeschichte geschrieben hat.“
In einem wegweisenden Urteil im April 2024 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten einer Gruppe älterer Schweizerinnen. Diese hatten ihre Regierung beschuldigt, durch unzureichenden Klimaschutz ihre Menschenrechte zu verletzen. Es war das erste Mal, dass ein Land wegen mangelnden Engagements im Klimaschutz verurteilt wurde. Der Umweltverband WWF nannte das Urteil einen „Weckruf für Regierungen, die bisher nicht ausreichend gehandelt haben“.
Grundrechte und die persönliche Betroffenheit
Wenn es um die Grundrechte geht, dann gilt: Die Kläger müssen persönlich betroffen sein, sie können also nicht stellvertretend für andere klagen. Darum können nur sie diese Klage führen, auch wenn es ihnen nicht nur um sich selbst, sondern auch etwa um Generationengerechtigkeit geht, so Wydler-Wälti. Die Klimaseniorinnen wollen laut eigener Aussage erreichen, dass die Emissionsziele ihres Landes verschärft werden.
Die Schweiz habe ihren CO2-Ausstoß zum großen Teil ins Ausland verlegt, durch eine Vielzahl an Importen, aber auch, weil viele Banken, Rohstoffe und Großkonzerne über die Schweiz liefen. „Das müssen wir auch mit einbeziehen, das müssen wir auch mit verantworten“, fordert die Co-Chefin der Schweizer Klimaseniorinnen.
Der Schweizer Bundesrat, also die Regierung der Schweiz, hat das Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hingegen kritisiert und infrage gestellt, ob der Gerichtshof überhaupt zuständig ist, über solche Fragen zu entscheiden. Der Gerichtshof habe mit dem Urteil seine Befugnisse überschritten.
Die Schweizer Regierung ist außerdem der Ansicht, dass die Schweiz genug für den Klimaschutz tue. Sie verweist dabei auf ein neues CO₂-Gesetz und ein Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien. Diese Maßnahmen seien wichtig, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe diese neuen Gesetze in seinem Urteil jedoch nicht berücksichtigt.
Die sechs jungen Portugiesen hatten sich nach den Waldbränden in Zentralportugal nach einer Hitzewelle im Juni 2017 zusammengetan. 100 Menschen starben, riesige Flächen Wald wurden zerstört. Bei diesen jungen Portugiesen war das der Moment, als sie erkannten, dass sie etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Sie reichten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klage gegen 32 Staaten ein, die sich ihrer Meinung nach nicht an die im Pariser Klimaabkommen getroffenen Ziele zur Eindämmung der Erderwärmung halten.
Die jungen Kläger sehen wegen mangelnden Klimaschutzes drei ihrer Rechte verletzt, die in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte verbrieft sind: das Recht auf Leben (Artikel 2), das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 8) sowie das Diskriminierungsverbot (Artikel 14).
Es war das erste Mal, dass sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so explizit mit dem Klimawandel befasst hat. Allerdings wurde die Klage im April 2024 abgewiesen: Die Jugendlichen hätten sich unter anderem zuerst in Portugal durch die Instanzen klagen müssen, bevor sie den Gerichtshof in Straßburg anrufen.
Am 14. August 2023 hatten Hauptklägerin Rikki Held und 15 weitere jugendliche Kläger im US-Bundesstaat Montana Grund zur Freude: Das Gericht urteilte, dass Montana ihr Verfassungsrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt verletzt habe. Künftig müssen Behörden des Bundesstaats möglicherweise die Folgen für das Klima prüfen, bevor sie ihre Zustimmung zu Erdöl- oder Erdgasprojekten geben.

Montana ist einer der wenigen Bundesstaaten, die das Recht auf saubere Umwelt für heutige und künftige Generationen in der Verfassung verankert haben. Gleichzeitig bezieht der Bundesstaat nach Aussagen der New York Times ein Drittel seiner Energie aus fossiler Energie. Klägerin Taleah Hernandez sagte, sie habe den Eindruck, der Bundesstaat stelle Profit über das Wohlergehen der Menschen, „obwohl sie genau wissen, dass es sichtbare Schäden gibt für das Land und die Menschen“.
Klägerin Rikki Held: Vieh ist wegen der Dürre gestorben
Hauptklägerin Rikki Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt, sagte vor Gericht aus, dass Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre die Existenzgrundlage und das Wohlergehen ihrer Familie gefährdeten. Sie erinnere sich an Waldbrände, bei denen Stromkabel über Dutzende Kilometer hinweg verbrannt seien, „so dass wir einen Monat lang keinen Strom hatten“.
Klimawissenschaftler im Kreuzverhör
Der Klimajurist Michael Gerrard von der Columbia Universität nannte das Urteil im US-Nachrichtensender NPR „einen Wendepunkt“. Erst zum zweiten Mal seien Klimawissenschaftler im Zeugenstand ins Kreuzverhör genommen worden, so Gerrard.
Die Agrarstudentin Sophie Backsen von der Insel Pellworm und Luisa Neubauer von Fridays for Future zeigten sich am 29. April 2021 erleichtert und glücklich. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bewertete das Klimaschutzgesetz in Teilen als verfassungswidrig – es müsse nachgebessert werden.
Epochales Urteil in Karlsruhe
Die Klagenden würden durch die gesetzlichen Regelungen in ihren Freiheitsrechten verletzt, urteilte Karlsruhe. „Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030,“ so die Richterinnen und Richter. Den Anstieg der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, sei dann nur mit immer dringenderen und kurzfristigeren Maßnahmen machbar. Im Gesetz fehlten ausreichende Vorgaben, wie genau die Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 gemindert werden sollen, so das oberste deutsche Gericht.
Backsen und Neubauer gehörten zu einer großen Gruppe vorwiegend junger Klägerinnen und Klägern aus dem In- und Ausland. Unterstützt wurden diese von Greenpeace und von weiteren großen Umweltschutzorganisationen wie BUND, Germanwatch und der Deutschen Umwelthilfe, dem Solarenergie-Förderverein Deutschland und Protect the Planet unterstützt.
Organisation dürfen in Deutschland nicht selbst klagen, sondern nur Menschen, die unmittelbar in eigenen Grundrechten betroffen sind. In den Niederlanden ist das anders, dort hatte 2019 die Umweltschutzorganisation Urgenda erfolgreich geklagt – mit dem Ergebnis, dass das Tempolimit auf Autobahnen verschärft und der Kohleausstieg beschleunigt wurde.
Sophie Backsens Famile war neben zwei anderen Familien von der Umweltschutzorganisation Greenpeace angesprochen worden, ob sie sich an der Klimaklage beteiligen würde. Backsen studierte zu der Zeit Agrarwissenschaft und will später vielleicht den Biohof ihrer Eltern auf der nordfriesischen Insel Pellworm übernehmen. Pellworm liegt schon jetzt teilweise unter dem Meeresspiegel. Dort vernünftig Landwirtschaft zu betreiben, wird künftig immer komplizierter, sagte Sophie Backsen. Sie will ein Recht auf Zukunft, hatte Sophie Backsen argumentiert.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Klimaklagen können Klimapolitik zwar nicht ersetzen, sie aber vorantreiben. Sie stoßen gesellschaftliche Debatten an und üben somit Druck sowohl auf Regierungen als auch auf Unternehmen aus. Indirekt nehmen sie damit also sehr wohl Einfluss auf den Klimaschutz.
Die Zahl sogenannter Strategischer Klagen hat in den vergangenen Jahren nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in vielen anderen Rechtsgebieten zugenommen. Bürger- und Menschenrechtsorganisationen nutzen dieses Instrument, um auf gerichtlichem Weg ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen.
Die Geschichten der Kläger und Betroffenen erzählen
Befürworter sagen, die politische Debatte werde dadurch bereichert und das Rechtsbewusstsein insgesamt gestärkt. Für Caroline Schroeder von der Umweltorganisation Germanwatch zählt aber noch etwas anderes:
Klimaklagen geben der Problematik des Klimawandels ein Gesicht, die Bedeutung der Klagen sei daher nicht nur juristisch. Es gehe auch darum, „diese Geschichten zu erzählen, von diesen Klägern, aus ihrem Alltag: Inwieweit sind die betroffen? Was macht die Klimakrise eigentlich? Was hat das mit den Grundrechten zu tun?“
tha, rzr, og