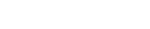Die Wirtschaftsweisen prognostizieren in ihrem Frühjahrsgutachten eine Stagnation der deutschen Wirtschaft. Das Beratergremium der Bundesregierung senkte seine Konjunkturprognose für dieses Jahr und rechnet mit einem Nullwachstum des Bruttoinlandsprodukts. Im Herbst hatte der
Sachverständigenrat noch mit einem Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet.
Für 2026 sind die Expertinnen und Experten etwas optimistischer und prognostizieren ein Wachstum von 1,0 Prozent. Doch ob Deutschland auch mittel- und
langfristig zurück in die wirtschaftliche Erfolgsspur findet, ist aus
Sicht der Experten alles andere als sicher. Die Preise dürften durch die Inflation laut dem Gremium in diesem Jahr um 2,1 Prozent und im nächsten Jahr um 2,0 Prozent steigen. Damit sei die Inflation auf einem guten Kurs.
Milliardeninvestitionen könnten starkes Wachstum auslösen
Vor allem die unkalkulierbare US-Zollpolitik, aber auch die angekündigten Milliardeninvestitionen der neuen Bundesregierung würden die Wirtschaft in nächster Zeit beeinflussen. Durch die hohe Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft würden sie die US-Zölle deutlich treffen. Das geplante Finanzpaket hätte aber ein großes Potenzial, wenn es investitionsorientiert eingesetzt würde.
Die Wirtschaftsweisin Veronika Grimm sagte, die zuletzt schwächelnde Baubranche dürfte durch die Infrastrukturmilliarden wieder stark anziehen. Auch die gesteigerten Verteidigungsausgaben können ihr zufolge einen Wachstumsimpuls geben. Gleichzeitig warnte sie davor, dass sich auch die Inflation erhöhen könnte, wenn zu viel Geld in den Konsum fließt. Daher seien bestimmte Schritte dringend nötig, um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen.
Grimm Kollege Achim Truger sprach von einem möglichen 4,6-prozentigen Plus der Wirtschaftsleistung im Jahr 2029, wenn das Geld zielgerichtet investiert werde – im Vergleich zur Wirtschaftsleistung 2029 ohne Finanzpaket. Das Finanzpaket erweitere die Spielräume erheblich, wenn es allerdings zweckentfremdet genutzt werde, könnten die Wachstumseffekte auch verpuffen. Unsicher sei zudem, ob das Paket mit den neuen EU-Fiskalregeln vereinbar sei. Die sei nur bei hoher Investitionsorientierung und begleitenden Strukturreformen gegeben.
Klare Regeln für Finanzpaket gefordert
Ulrike Malmendier, ebenfalls Mitglied des Expertenrates, forderte mehr Regeln, damit die Gelder nicht konsumptiv eingesetzt werden. Sonst könnten bereits geplante Inventionen aus dem Kernhaushalt verschoben werden, um Vorhaben wie die sogenannte Mütterrente, die Subventionen beim Agrardiesel und die geringere Gastrosteuer zu finanzieren. „Der bestehende Spielraum für solche Querfinanzierungen beträgt 50 Milliarden pro Jahr.“
Malmendier schlug vor, für Militärausgaben eine Quote von zwei Prozent im Kernhaushalt festzuschreiben. Beim Sondervermögen solle eine Investitionsquote von zehn Prozent des Kernhaushaltes in das Errichtungsgesetz übernommen und im weiteren Verlauf auf zwölf Prozent angehoben werden. Ähnliche Regeln forderte Malmendier für den Klima- und Transformationsfonds und die Milliarden für die Bundesländer.
Werding: „Bürokratie muss entrümpelt werden“
Der Wirtschaftsweise Martin Werding forderte, die Bürokratie in Deutschland abzubauen. Sie müsse „entrümpelt“ werden. Das Gremium schlägt deshalb unter anderem weniger Informationspflichten, schnellere
Antrags- und Genehmigungsverfahren und eine Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung vor. Ziel sei es, nicht nur bestehende Auflagen zu
verringern, sondern auch einem erneuten Bürokratieanstieg vorzubeugen.
Mit Massentlassungen aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche rechnen die Wirtschaftsweisen nicht. Falls sich der Zollkonflikt
mit den USA verschärfen sollte, könnte dies aber spürbare Folgen in der
deutschen Industrie haben, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Monika Schnitzer.
Wirtschaftsweise lehnen Merz‘ Ruf nach „mehr Arbeit“ ab
Die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz im Bereich
der Arbeitspolitik sieht der Expertenrat skeptisch. Es sei richtig, dass es Anreize brauche,
um die Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen, sagte Veronika Grimm. Besonders viel Potenzial
sehe sie aber etwa in einer stärkeren Beteiligung von Frauen am
Arbeitsmarkt, etwa durch eine Verbesserung der Kinderbetreuung. Schnitzer schlug vor, das Ehegattensplitting abzuschaffen oder zu reformieren, um den Anteil der Frauen in Arbeit zu erhöhen.
Merz hatte wiederholt gefordert, dass die Menschen
in Deutschland mehr arbeiten. „Mit Vier-Tage-Woche und
Work-Life-Balance können wir den Wohlstand nicht erhalten“, sagte er zuletzt in einer Rede vor dem CDU-Wirtschaftsrat.