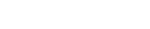Ein Defekt am Datenkabel „C-Lion1“ in der Ostsee hat im November 2024 erneut gezeigt, wie anfällig Unterseekabel und Pipelines sind. Schon der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline machte deutlich, wie schwer es ist, Saboteure ausfindig zu machen.
Weil diese Leitungen auf dem Meeresgrund mögliche Ziele in einem Krieg sind, werden sie inzwischen von vielen Staaten als kritische Infrastruktur eingestuft. Um sie besser zu schützen, setzen Militär, Forschung und Industrie verstärkt auf Hightech. Ein neues NATO-Zentrum für den Schutz dieser Infrastruktur wurde gegründet, und auch die Marinen der Anrainerstaaten bauen ihre Präsenz in der Ostsee aus. Doch der Schutz unter Wasser ist nicht nur technisch anspruchsvoll – auch das Seerecht setzt Grenzen.
Gas, Strom, Telefongespräche, E-Mail- und Internetkommunikation: Eine riesiges Netz von Pipelines und Tiefseekabeln transportiert Daten und Energie durch die Weltmeere.
So läuft beispielsweise 99 Prozent des weltweiten Internet-Verkehrs über Hunderte Datenkabel mit einer Gesamtlänge von über einer Million Kilometern auf dem Meeresgrund. Europa ist über etwa 250 land- und seegestützte Leitungen mit dem Rest der Welt verbunden.
Und submarine Versorgungsstrukturen werden in Zukunft immer wichtiger. Denn der Strom, den immer mehr Off-Shore-Windanlagen produzieren, wird via Tiefseekabel ins Stromnetz eingespeist.
Greifen Staaten die Strom- und Telekommunikationskabel oder die Systeme zur Gewinnung von Bodenschätzen anderer Staaten an, spricht man von „Seabed Warfare“, zu Deutsch: Kriegsführung am Meeresgrund. In der Nordsee ereignete sich ein solcher Fall wohl 2021, als unbekannte Täter eine Forschungseinrichtung vor der Küste Norwegens angriffen. Daten- und Stromkabel der Unterwasseranlage wurden durchtrennt, mehr als vier Kilometer Kabel entwendet.
Im September 2022 wurde ein Anschlag auf die beiden Gas-Pipelines Nordstream 1 und 2 in der Ostsee verübt. Durch vier Sprengungen wurden Abschnitte der Röhren zerstört, große Mengen Erdgas entwichen ins Meer.
Recherchen von ARD, Zeit und Süddeutscher Zeitung deuten darauf hin, dass der Anschlag von Spitzen des ukrainischen Militärs geplant und autorisiert wurde. Die ukrainische Regierung hat aber immer wieder bestritten, an der Sabotage-Aktion beteiligt gewesen zu sein.
Der Generalbundesanwalt hat Haftbefehl gegen einen ukrainischen Staatsbürger erlassen, der an dem Anschlag beteiligt gewesen sein soll. Der Verdächtige konnte jedoch nicht festgenommen werden und soll sich wieder in der Ukraine befinden.
Ein weiterer Angriff wurde Anfang 2023 anscheinend verhindert. Der niederländische Geheimdienst MIVD warnte damals, Russland bereite möglicherweise Sabotageakte in der Nordsee vor. Russische Akteure hätten versucht herauszufinden, wie die Energieversorgung in der Nordsee organisiert ist – vielleicht mit der Absicht, sie zu stören, wenn sie es wollten, erklärte MIVD-Chef Jan Swillens im Februar 2023.
Ende 2023 wurde die Ostsee-Pipeline „Balticconnector“ zwischen Finnland und Estland beschädigt – laut finnischen Ermittlern wahrscheinlich durch den Anker eines chinesischen Containerschiffs. Ob es ein Unfall oder Sabotage war, ist bis heute unklar. Auch ein Datenkabel zwischen beiden Ländern wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Angriff auf die Unterwasser-Infrastruktur der Nordsee kann erhebliche Folgen für die Datensicherheit und Energieversorgung haben. Sabotieren Angreifer Stromkabel, kann das dazu führen, dass Windräder still stehen oder sogar in einer gesamten Region der Strom ausfällt.
Und die Energie-Infrastruktur in der Nordsee könnte künftig sogar noch verwundbarer werden. Der niederländische Netzbetreiber Tennet plant Plattformen, die den Strom mehrerer Windparks bündeln und an Land schicken sollen. Das wäre genau das richtige Ziel für einen russischen Raketenschlag, falls der Ukraine-Krieg eskaliert, glaubt Frederik Mertens.
Auch Datenkabel sind kritische Ziele: Mit dem richtigen Equipment können sie gekappt oder abgehört werden. So führte beispielsweise im November 2024 ein Defekt an dem Untersee-Datenkabel „C-Lion1“ zwischen Finnland und Deutschland dazu, dass die Kommunikationsverbindungen über das Kabel unterbrochen wurden. Es ist das einzige Untersee-Datenkabel, das direkt von Finnland nach Mitteleuropa führt.
Zudem wurde im November 2024 ein weiteres Kabel zwischen Schweden und Litauen beschädigt, wie das schwedische Kommunikationsunternehmens Telia bestätigte. Nach Erkenntnissen der litauischen Marine liegt die Beschädigung in internationalen Gewässern.
Die internationalen Marinen sind bereits gut ausgestattet und verfügen über ein Lagebild unter Wasser, sagt Claudia Lilienthal, Expertin für maritime Systeme beim Rüstungsunternehmen ESG. Trotzdem wollen viele Staaten ihre Tiefseeanlagen noch besser schützen und sich auf mögliche Sabotageakte vorbereiten.
Großbritannien setzt ein Spezialschiff mit unbemannten Tauchbooten ein, Frankreich baut seine Marineaktivitäten aus, und auch die Bundeswehr sieht in ihrer Strategie „Marine 2035“ den Unterwasserkrieg als reale Bedrohung. Das NATO-Kommando MARCOM koordiniert vier ständige Marineeinheiten, die in der Ostsee patrouillieren. Außerdem entsteht ein neues NATO-Zentrum zum Schutz kritischer Infrastruktur – mit der Software „Mainsail“, die bei Gefahren für Kabel oder Pipelines Alarm schlagen soll. Noch ist sie aber ein Prototyp.
Auch die Betreiber selbst, etwa aus der Energie- oder Telekommunikationsbranche, sollen künftig mehr Verantwortung für den Schutz ihrer Anlagen übernehmen. Netze werden robuster gebaut, oft mit zusätzlichen Kabeln für den Notfall. Gleichzeitig investieren Forschung und Behörden in Überwachungstechnik, zum Beispiel in autonome Unterwasserfahrzeuge oder in sogenannte Distributed Acoustic Sensing-Systeme. Dabei dienen Glasfaserkabel selbst als Sensoren, die Vibrationen erkennen sollen.
Wenn ein Seekabel aber nicht nur Daten überträgt, sondern zusätzlich zur Überwachung genutzt wird, könnte es in Konflikten selbst zum Angriffsziel werden. Außerdem verhindern Sensoren nicht alle Vorfälle, umso wichtiger sind daher auch schnelle politische Reaktionen.
Länder wie Finnland und die USA haben dafür feste Meldepflichten eingeführt: Wenn ein Schaden an einem Unterseekabel oder einer Pipeline entdeckt wird, muss dieser innerhalb einer bestimmten Frist an eine zentrale Stelle gemeldet werden. In vielen anderen Staaten fehlen solche Regeln. Fachleute fordern deshalb mehr politische Verantwortung und einheitliche Standards. In Deutschland soll zum Beispiel das geplante KRITIS-Dachgesetz ab 2026 für klare Vorgaben sorgen. Auch die EU-Staaten wollen beim Schutz grenzüberschreitender Infrastruktur enger zusammenarbeiten.
Beschädige beispielsweise ein unter ausländischer Flagge fahrendes Schiff ein Unterseekabel, habe der Küstenstaat zwar das Recht, Maßnahmen zu ergreifen, aber nur in den eigenen Hoheitsgewässern. Zudem müssen „Beweise für eine bösartige Absicht vorliegen“, so Coventry.
Kreuzt der Saboteur in internationalen Gewässern und handelt es sich um ein Marineschiff oder ein staatliches Forschungsschiff, dürfen patrouillierende Schiffe eines anderen Staates nicht einschreiten.
Marten Hahn, Deutschlandfunk, tmk, kau