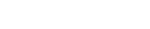Sprichwörter bewahren Weisheiten, die viele Menschen über lange Zeit als richtig erlebt und empfunden haben. Damit kann kein Ratgeber unserer Gegenwart mithalten. Es wird Zeit, diesen oft seit Jahrtausenden überlieferten Erfahrungsschatz wiederzuentdecken.
Vor 2500 Jahren wurde in Jerusalem die erste Ratgeberliteratur produziert. Und weil schon damals der Rat einer allgemein anerkannten Autorität mehr Gewicht hatte als die Weisheiten von Orje Krawuttke (was auch immer das hebräische Pendant zu Orje Krawuttke sein könnte), gaben die Ghostwriter König Salomo als Urheber ihrer Sprüche aus.
Dabei waren die hebräischen Lifehacks teilweise so alt, dass sie zu Zeiten Salomos, der irgendwann 900-1000 Jahre vor Christi Geburt regiert haben soll, schon über mindestens 40 Generationen von Mund zu Mund weitergegeben worden waren. Die Forschung nimmt an, dass manche von ihnen 4000 Jahre oder noch älter sind.
Von geschicktem Marketing zeugt auch der Aufbau des Buches, das in der Luthers Bibelübersetzung „Sprüche Salomos“ heißt. Es ist in sieben Teile gegliedert, denn im Spruch 9,1 heißt es: „Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen.“ Dieser etwas mystisch wirkende Satz sollte aber niemanden täuschen. In seiner unmittelbaren Nähe steht auch der Spruch: „Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse; rüge den Weisen, der wird dich lieben“, der in archaischer Sprache eine Wahrheit ausdrückt, die heute noch für jede geschäftliche Konferenz und jeden Online-Disput gilt: Mit Idioten diskutiert man nicht.
Wenn viele dieser uralten Sprüche heute noch als Sprichwörter gängig sind, dann hat das weniger mit der Autorität der Bibel und Salomos zu tun, als mit den Lebenserfahrungen, die in ihnen konserviert ist – und mit Realitäten, die sich seit der Bronzezeit oft genug kaum verändert haben. Zwar sind mit dem Absinken der allgemeinen Bibelfestigkeit viele Weisheiten verschwunden, die Menschen früherer Jahrhunderte noch ganz geläufig waren. Der Theologe Rainer Metzner schreibt in seinem neuen Buch: „Ein Großteil der biblischen Sprichwörter, die in die klassischen Sammlungen des 19. Jahrhunderts aufgenommen wurden, ist heute unbekannt. Das hängt damit zusammen, dass die Lebensumstände, denen die Sprichwörter entlehnt sind, vielfach weggebrochen sind (Recht, Arbeit, Sitte, Kultur usw.).“
Doch dann zitiert Metzner den großen Sprichwortforscher Wolfgang Mieder: „Wiederum andere überleben schon seit Jahrtausenden, weil sie zu den grundlegenden Einsichten des Daseins gehören.“ So war es schon in den bis zu 1500 Jahren, bevor die „Sprüche Salomos“ und andere Schriften des Alten Testaments aufgezeichnet wurden. Wenn Weisheiten in der Bibel mehrfach vorkommen, so Metzner, zeige dies, „dass sie in verschiedenen Traditionskreisen und über längere Zeit abrufbar blieben.“
Zu jenen uralten Erfahrungsschätzen, die gleich mehrere Autoren der Bibel für aufzeichnungswürdig hielten, gehören „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“, „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinen anderem zu“, „Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande“, „Der Glaube versetzt Berge“, „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert“ und „Dem Ochsen, der da drischt, soll man das Maul nicht verbinden“.
Der letztgenannte Spruch ist eines von vielen Beispielen dafür, dass auch Sprichwörter, deren Metaphorik nicht mehr eng mit unserer Lebenswelt verknüpft ist, Erfahrungen konservieren, die heute noch gültig sind. Denn obwohl keiner mehr mit Ochsen drischt und man sogar das Wort „dreschen“ wahrscheinlich vielen Menschen heute erklären muss – es bezeichnet den mechanischen Vorgang, mit dem man die Körner aus dem Getreide löst –, besagt der Satz doch schlicht: Wenn man jemanden für sich arbeiten lassen will, muss auch für ihn ein Gewinn dabei rausspringen.
Rainer Metzner schreibt in seinem Buch, dass das Sprichwort, das zuerst im fünften Buch Mose belegt ist, ursprünglich tatsächlich eine Tierschutzbestimmung war. Die Tiere – Kühe oder Esel –, die man auf den Halmen herumtrampeln ließ, damit sie mit ihren Hufen die Körner aus den Halmen drücken oder die für den gleichen Zweck einen Schlitten über das ausgebreitete Getreide zogen, sollte ein guter Bauer nicht am Fressen hindern. Doch Jahrhunderte später habe es Paulus umgedeutet. Im Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt er, dass der Spruch „Einem dreschenden Rind sollst du keinen Maulkorb anlegen“ nicht um der Ochsen willen, sondern „um unseretwillen“ geschrieben ist. Der Apostel, der das Evangelium predige, dürfe für seine geistliche Arbeit „Fleischliches“ (gemeint ist Unterhalt) und Respekt erwarten.
Mit dieser Umdeutung beginnt die eigentliche Karriere des Sprichworts, dass das Gleiche besagt, wie der von Paulus erstmals geprägte Spruch „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert“. Es ist kein Zufall, dass es von einem großen Bibelkenner, der für Arbeiterrechte predigte, aufgegriffen wurde. In seinem Drama „Leben des Galilei“ lässt Bertolt Brecht seinen Titelhelden, den italienischen Astronomen, der unser Bild der Welt umstürzte, darüber klagen, dass die Universität Padua ihn so schlecht bezahlt, dass er sein Gehalt mit Privatunterricht aufbessern muss – was ihn an der Forschung hindert: „Ihr verbindet dem Ochsen, der da drischt, das Maul.“ Darin steckt auch eine autobiographische Erfahrung: Geschrieben wurde das Stück in den frühen Vierzigerjahren, als Brecht in Hollywood versuchte, mit Drehbuchentwürfen Geld zu verdienen – statt mit seiner eigentlichen Kunst.
Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange Erfahrung gründet
Was Brecht wusste und was einem Metzners Buch eindrücklich klarmacht: „There is nothing new under the sun“ – so die englische Version des in viele Kulturkreise als Sprichwort eingegangenen Bibelweisheit „Es geschieht nichts Neues unter der Sonne“, die ebenfalls Salomo zugeschrieben wird. Nichts was ein Coach, Mental-Trainer, Therapeut oder sonstige Ratgeber über Resilienz, Self Care, Gesundheit und Achtsamkeit erzählen kann, steht nicht schon in einem alten Sprichwort. Denn menschliche Verhaltensweisen, Psychomuster, Sorgen, Hoffnungen, Finanzgebaren, Marktrealitäten, gesellschaftliche Regeln und vor allem unsere Körper sind über viele Jahrtausende hinweg erstaunlich gleich geblieben.
Miguel de Cervantes, der Autor des „Don Quixote“ hat es auf den Punkt gebracht: „Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange Erfahrung gründet.“ Und diese Erfahrung kann in eine Zeit zurückreichen, in der Schrift noch nicht jedem zur Verfügung stand. Rainer Metzner schreibt über Sprichwörter: „Sie sind wie Legenden, Mythen, Märchen, Fabeln, Sagen, Rätsel und Witze vorliterarische Textgattungen, die aus alten überwiegend mündlich geprägten Zeiten stammen.“ Auch wenn sie vordergründig oft alte Sitten und Gebräuche widerspiegeln, sind die persönlichen und sozialen Angelegenheiten, die sich darin wiederfinden, fast immer vertraut.
Diese „Weisheiten aus zweiter Hand“, wie sie der Germanist Karl-Heinz Göttert nennt, dienten in überwiegend mündlich geprägten Kulturen dazu Erfahrungswissen oder auch als vernünftig empfundene soziale Maximen über Generationen weiterzugeben. Das „Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini“, nennt das Sprichwort ein „Lebensweisheit, die bestimmte gesellschaftliche Erfahrungen in hohem Grade verallgemeinert“. Der Sprichwortforscher Wolfgang Mieder charakterisiert es: „Ein allgemein bekannter, fest geprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.“
Zwar ist nicht alles in den Sprichwörtern auf eine banale vordergründige Weise wahr. Es stimmt, wenn der Sprachkritiker Wolf Schneider spöttelt, der Satz „Ehrlich währt am längsten“ entspreche kaum der massenhaften Lebenserfahrung und dasselbe gelte für eine „tollkühne Behauptung“ wie „Jung gefreit nie bereut“. Doch im ersten Satz ist eben das Wissen aufgehoben, dass der Ehrliche in früheren Zeiten deutlich bessere Chancen hatte, nicht gevierteilt, gehängt und von Raben gefressen zu werden. Und die Überzeugung, dass Gesellschaften, die auf Vertrauen basieren, überlebensfähiger sind, ist längst von der Soziologie bestätigt. Die Wahrheit der zweiten Behauptung offenbart sich, wenn man sie umdreht: So gut wie jeder, der erst spät heiratet und Kinder kriegt, bedauert es, das nicht schon früher getan zu haben.
Kein Satz wird zum Sprichwort, wenn er nicht über lange Zeit bei sehr vielen Menschen ihrer Alltagserkenntnis entsprach. Der Theologe Metzner hat die Themen identifiziert, nach denen sich die Bibelworte ordnen lassen, darunter solche, mit denen sich auch heute noch Geld als Coach, Therapeut oder Berater verdienen lässt: „Tun und Arbeit“, „Familie und Freundschaft“, „Leben und Tod“, „Recht und Unrecht“, „Schaden und Unheil“. Für alle gilt: „Wiederholte Beobachtung und Erfahrung ruft allgemeingültige Sentenzen war, die als tradierte Weisheit menschlichen Verhaltens weitergegeben werden.“ Allerdings differenziert er: „Die Allgemeingültigkeit eines Sprichworts meint jedoch keine absolute, unbedingte, zeitlose Wahrheit, sondern eine bestimmte, die relativ zu gegebenen Lebenssituationen und Umständen gilt.
Der Sprichwortschatz, der weit über den biblischen Fundus hinausgeht, bildet in seiner zigtausendfachen Vielfalt auch die Komplexität des Lebens ab. Was für den einen Menschen passt, kann für den anderen schädlich sein. Was in der ersten Situation hilft, kann in der zweiten das Gegenteil von richtig sein.
Deshalb existieren Sprichwörter, die sich scheinbar widersprechen. Mal fügt sich Gleiches zusammen – dann passt „Gleich und gleich gesellt sich gern“ –, mal nicht – dann ist „Gegensätze ziehen sich an“ angemessener. Zur Genügsamkeit rät „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, das Risiko empfiehlt „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.
Dass die richtige Wahrheit den richtigen Moment braucht, wussten auch schon die Jerusalemer Ratgeberautoren, die Salomo den Spruch in den Mund legten: „Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben hat seine Stunde.“ Der Folksänger Pete Seeger hat darauf 1959 das Lied „Turn! Turn! Turn!“ aufgebaut, in dem es heißt „For every thing there is a season“. Zum Welt-Hit wurde der Song 1965, als die Byrds ihn aufnahmen. Damals suchte die sich formierende Hippie-Jugend nach östlichen Weisheiten – und fand sie ausgerechnet in einem vermeintlich langweiligen Buch, das schon ihre Eltern Rat und Halt gegeben hatte.
Rainer Metzner: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Die Sprichwörter der Bibel, EVA, 48 Euro