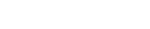Jemand hat ein frisches Blumengesteck neben die schwarze Steinplatte am Boden gelegt. „Stärke uns, um weiterzumachen” steht am Schluss einer längeren Inschrift. Sie bezieht sich auf die Statue in der Nähe, die einen Farmer darstellt. Mit aufrechter Haltung steht er da, reckt mit ausgestrecktem Arm eine Bibel in die Höhe, über die bunten Werbefahnen und Rauchschwaden der Grillstände hinweg.
Die sonnenüberflutete Gedenkstätte befindet sich mitten auf einer Agrarmesse im südafrikanischen Bothaville. Sie erinnert an ein trauriges Kapitel südafrikanischer Geschichte: an die Farmer und Farmarbeiter, die seit 1961 in Südafrika ums Leben gekommen sind. Statistisch gesehen bilden diese „Farm Murders“ (Farmmorde) nur einen kleinen Teil aller Gewalttaten im Land. Doch in Südafrika ist es ein besonders emotionales Thema, das Verbände, die die Interessen der weißen Bevölkerung vertreten, seit Jahren zu politischen Zwecken nutzen. An diesem Mittwoch wird es auf großer internationaler Bühne im Zentrum eines Treffens von Cyril Ramaphosa mit Donald Trump in Washington stehen, wenn der südafrikanische Präsident versucht, das Bild Südafrikas geradezurücken und die schwer beschädigten Beziehungen mit den USA zu kitten.
Zu der Agrarmesse, der größten dieser Art in der südlichen Hemisphäre, pilgern jedes Jahr Tausende Besucher. Unternehmen stellen landwirtschaftliche Geräte und jeglichen landwirtschaftlichen Bedarf aus, Autokonzerne von Suzuki bis Porsche präsentierten wuchtige, geländefähige Fahrzeuge. Es ist ein Sehen und Gesehenwerden mit viel PS und Prominenz. Auf dem eigens angelegten „Airstrip“ landeten am ersten Tag allein 85 Flugzeuge und 16 Hubschrauber.
In diesem Trubel sei die „Mauer des Gedenkens“ in früheren Jahren nicht viel beachtet worden, erzählt ein Messebesucher der F.A.Z. am Telefon. Dieses Mal sei das anders gewesen. Abgesehen von der Gedenkplatte und der Statue besteht die Stätte aus neun mehrere Meter hohen Stelen. Auf jeder sind in langen Kolonnen Namen eingraviert, auf allen vier Seiten von oben bis unten: Jahreszahlen, Familiennamen und die Orte, sortiert nach den neun südafrikanischen Provinzen. Namen weißer Farmer wie Steenkamp finden sich, aber auch die Namen schwarzer Südafrikaner, die vermutlich als Arbeiter auf den Farmen arbeiteten. Auch er habe sich die Zeit genommen und die Namen studiert, sagt der Besucher. Allein die Fülle der Namen sei erschütternd. „Es sieht aus wie ein Kriegsdenkmal.“
Südafrikas chronisches Kriminalitätsproblem
Und dennoch ist die Empörung in Südafrika groß gewesen, als die amerikanische Regierung in der vergangenen Woche 49 Afrikaaner – also die Nachfahren der überwiegend aus den Niederlanden stammenden Siedler vor 400 Jahren – in Empfang genommen hatte. Selbst weiße Interessenvereinigungen hätten vorher nicht erwartet, dass die US-Regierung, die die Tore für Menschen aus Krisengebieten weitgehend geschlossen hat, per Dekret im Februar ein Flüchtlingsprogramm für diese Bevölkerungsgruppe starten würde. Die Farmmorde werden als einer der Hauptgründe genannt.
Dass Südafrika ein chronisches Kriminalitätsproblem hat, ist weithin bekannt. Niemand bestreitet, dass dagegen dringend etwas unternommen werden muss. Im vergangenen Jahr wurden nach der Polizeistatistik mehr als 26.000 Menschen ermordet. Zum Vergleich: Im gleichen Jahr waren es in Deutschland mit einer größeren Bevölkerung nach Angaben des Bundeskriminalamts 2300 Fälle. Trump jedoch spricht von „massiven Menschenrechtsverletzungen“, ohne Belege zu präsentieren. Wiederholt behauptete er, dass Afrikaaner und in besonderem Maße afrikaanse Farmer aus rassistischen Gründen verfolgt, enteignet und ermordet würden. Der in Südafrika geborene Multimilliardär Elon Musk steuert vermeintliches Insiderwissen bei, indem er seit Jahren von einem „weißen Genozid“ und „Landraub“ in seinem früheren Heimatland spricht. Musk hat Südafrika im Alter von 17 Jahren verlassen.
Viele Statistiken machten die Runde, um das Gegenteil zu beweisen. Nach Angaben des Nationalen Statistikamts beispielsweise verdienen weiße Haushalte im Durchschnitt fast fünfmal mehr als schwarze Haushalte. Etwa drei Viertel der Landflächen im Privatbesitz gehören weißen Eigentümern, die aber nur sieben Prozent der Bevölkerung ausmachen. Forderungen populistischer Parteien nach Enteignungen ohne Kompensation schlugen zwar vor einigen Jahren hohe Wellen, doch enteignet oder vertrieben wurde bisher niemand.
Afrikaaner weiterhin stark vertreten
Ein neues „Enteignungsgesetz“, auf das die US-Regierung verweist, trat erst im Januar in Kraft. Nach Aussage der südafrikanischen Regierung zielt es nicht darauf ab, private Güter zu enteignen, sondern klare Regeln zu schaffen, um bei einem übergeordneten öffentlichen Interesse vor allem die Nutzung brachliegender Flächen zu ermöglichen. Nur unter bestimmten Bedingungen könne dabei keine Entschädigung entfallen.
Insbesondere Afrikaaner – aus dieser Volksgruppe stammten während der Apartheid alle Präsidenten und Regierungschefs – sind 30 Jahre nach dem Übergang zu einer Demokratie weiterhin stark in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Leben und in der Landwirtschaft vertreten. Es wurde vor der US-Reise darüber spekuliert, ob Ramaphosa den Afrikaaner und Unternehmer Johann Rupert, einen der reichsten Männer des Landes, zum Treffen mit Trump mitnimmt, um das Narrativ eines „weißen Genozids“ überzeugend zu widerlegen.
Ohnehin ist diese Auslandsreise mit kaum einer anderen zuvor zu vergleichen. Der südafrikanische Präsident, der einst aufseiten des Afrikanischen Nationalkongress (ANC) über die demokratische Verfassung verhandelt hatte, wird von einer großen Delegation begleitet, der mehrere Minister angehören, unter ihnen der weiße Landwirtschaftsminister John Steenhuisen. Das ist bemerkenswert, denn bisher hat der ANC die Außenpolitik ausschließlich als seine eigene Domäne betrachtet. Steenhuisen – er ist trotz des Namens kein Afrikaaner – führt die langjährige Oppositionspartei Democratic Alliance (DA), die neben anderen Parteien an der noch jungen Koalitionsregierung beteiligt ist.
Die Realität ist freilich vielschichtiger als die zu erwartenden Darstellungen während des Treffens in Washington. Bothaville befindet sich dort, wo viele der aus amerikanischer Sicht verfolgten Menschen leben, im tiefstem „Buren-Land“ mitten in der Provinz Free State. In diese Gegend zogen Mitte des 19. Jahrhunderts die Voortrekker, die Nachfahren der ersten afrikaansen Siedler. Mit ihren Ochsenkarren wanderten sie von der Kap-Kolonie an der Küste in das Landesinnere, auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Land und auf der Flucht vor den Briten. An jeder afrikaansen Schule wird heute ausführlich über diesen „Großen Treck“ unterrichtet, über die Überquerung des Vaal-Flusses und den Sieg der Voortrekker über die Zulus im grausamen „Battle of Blood River“. Viele Orte dort verdanken ihre Entstehung und ihren Namen den Voortrekkern, die sich angesiedelt und sofort mit der Landwirtschaft begonnen haben.
80 Prozent sind unzufrieden mit der Entwicklung des Landes
Heute wird Bothaville auch die „Mais-Hauptstadt Südafrikas“ genannt. Kaum zu überblickende Felder erstrecken sich außen herum. Wer zu der dort stattfindenden Agrarmesse gelangen wollte, musste sich durch unzählige Schlaglöcher auf den Straßen kämpfen, vorbei an etlichen verlassenen Gebäuden, die langsam verfallen. Jahrelanges Missmanagement der Behörden, Schlendrian und Korruption haben vielerorts in Südafrika ihre Spuren hinterlassen – auf dem Lande, in Provinzen wie dem Free State sind sie besonders deutlich.
In einer Umfrage des Instituts Afrobarometer äußerten sich kürzlich 80 Prozent der Befragten unzufrieden über die Entwicklung des Landes. Korruption, Arbeitslosigkeit und Stromausfälle standen an oberster Stelle der Beschwerden. Auch daran mag es gelegen haben, dass sich mehrere Tausend Afrikaaner für das amerikanische Flüchtlingsprogramm beworben hatten. Für die erste Gruppe suchte die US-Regierung letztlich nur ein paar Dutzend aus, die vermutlich die Kriterien erfüllten.
Auf der Agrarmesse war von Auswanderungswünschen und von Fluchtgedanken kaum etwas zu bemerken. Wie jedes Jahr kamen überwiegend Afrikaaner in ihrer typischen Farmerskluft, in kurzen Hosen und beigen, kurzärmeligen Hemden. Dazwischen mischten sich einige schwarze Großgrundbesitzer, unter ihnen der Staatspräsident, der bekanntlich ein begeisterter Büffelzüchter ist. Es herrschte beste Stimmung, weiße und schwarze Landwirte posierten an seiner Seite für Fotos. Er sei nicht als Präsident hier, sondern als Farmer, kokettierte Ramaphosa.
Am Ende beantwortete er aber doch die Fragen einiger Reporter zu den „Flüchtlingen“. Diese Männer und Frauen unterstützten offensichtlich nicht die Bemühungen, die Transformation in Südafrika nach dem Ende der Apartheid voranzubringen. Es sei ein „feiger Akt“ gewesen, sagte er unweit der Statue des stolzen Farmers mit der Bibel. „Wir Südafrikaner rennen nicht vor unseren Problemen davon.“