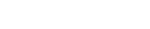Als der junge Bruce Springsteen im August vor fünfzig Jahren „Born to Run“ fertiggestellt hatte, jene Platte, die ihn zur Überfigur amerikanischer Popkultur machen sollte, führte ihn die anschließende Tour mit der E Street Band erst durch seine Heimat und dann nach England. In London spielte er zwei Nächte hintereinander. Dass Springsteen „the Future of Rock ’n’ Roll“ sei, hatte sich bis Europa herumgesprochen, aber auch, dass er die Zukunft seiner angekratzten Nation sein könnte: weil er einem Amerika Gesicht, Stimme und Sound gab, nach dem sich viele im Rest der Welt sehnten.
1975, das war das Jahr nach Watergate, das Jahr des verlorenen, miesen Vietnamkriegs: Springsteens Songs waren da wie ein Versöhnungsangebot an die Enttäuschten, nach innen und außen. Wenn ihr der Integrität der Leute im Weißen Haus nicht mehr traut, habt ihr recht – aber die Integrität des amerikanischen Traums ist intakt, und dafür bürge ich mit dem weißen Riff von „Born to Run“ und dem Solo meines schwarzen Saxophonisten Clarence Clemons.
Man muss das mitbedenken, wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, wie Springsteen, 75 Jahre alt, von einer Bühne in Manchester aus die Verhältnisse unter Trump kritisiert. Er kehrte damit in ein England zurück, das vor fünfzig Jahren das Sprungbrett seiner ganz persönlichen Welteroberung gewesen war.
„Das Amerika, das ich liebe“, sagte Springsteen dort also, in jenem sakralen Ton, den er sich in den vergangenen Jahren angewöhnt hat, „über das ich geschrieben habe und das über 250 Jahre hinweg ein Leuchtturm der Hoffnung und Freiheit gewesen ist, ist im Moment in den Händen einer korrupten, inkompetenten Regierung von Verrätern. Heute bitten wir alle, die an die Demokratie und an das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, sich mit uns zu erheben. Erhebt eure Stimme gegen Autoritarismus – und für die Freiheit.“
Warte nur, bis du nach Hause kommst, droht Trump
Danach hat erst mal Trump seine Stimme erhoben. Und Springsteen auf Truth Social als untalentiert, linksradikal und dumm bezeichnet, als eine „Dörrpflaume“, die sich erdreiste, im Ausland schlecht über den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen. Trump beendete seine Attacke (bei deren Lektüre man sich erinnern muss, dass hier ein Präsident der Vereinigten Staaten spricht) mit der Drohung: Warte nur, bis du nach Hause kommst!
Dabei war Springsteen zu Hause. Auf einer Bühne. Dem Ort, von dem aus der Sohn italienischer und irischer Vorfahren im Laufe seiner Karriere wieder und wieder kraft seiner Songs und einer mit seinem Publikum geteilten Wunscherfüllungspower für vier Stunden pro Konzert Harmonie erzeugen konnte. Ein herbeiphantasiertes Amerika geteilter Ideale, das es in der Form nur dort gegeben hat. Springsteen hatte ja auch in seinen Songs von Fabriken gesungen, in denen er selbst nie gearbeitet hatte. Sein Vater, nicht er, war der rastlose Typ gewesen, der immer nur on the run war.
Aber die rastlosen Typen aus den amerikanischen Fabriken (und nicht nur die) haben ihm immer geglaubt, dass er einer von ihnen ist. „I made it all up – that’s how good I am“, hat Springsteen vor einigen Jahren in seinem autobiographischen Broadway-Programm gesagt. Unter all den hinreißenden, erfundenen Zeilen seines Lebens war das die eine wahre: Ich hab mir das alles ausgedacht, und ihr habt mir geglaubt, weil ich so gut darin war.
Springsteens Gitarrist Steven Van Zandt hat kürzlich in einem Interview erklärt, dass sie die Hälfte ihres amerikanischen Publikums verloren hätten. Vielleicht muss Springsteen erkennen, dass er sich auch die überparteiliche Harmonie unter seinen Fans im Zeichen amerikanischer Ideale ausgedacht hat. Er war so gut darin, dass er sich das selbst geglaubt hat. Und wir mit ihm. Weil es so unwiderstehlich bleibt.