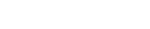Der starke Fokus auf den Wohnungsmarkt sei entscheidend gewesen für den beachtlichen Wahlerfolg der Linken, sagt Fraktionssprecherin Caren Lay. Nun will die Partei daran arbeiten, die Mieten auch wirklich zu senken – mit durchaus kontroversen Vorschlägen. So verteidigt Lay die Pläne.
Mehr als acht Prozent verzeichnete die Linkspartei bei der Bundestagswahl. In Berlin wurde sie sogar stärkste Kraft. Vor allem junge Leute wählten links. Weil sie von hohen Mieten besonders betroffen seien, sagt die Linken-Fraktionssprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik, Caren Lay.
Nun will sie sich für eine strengere Ahndung von Mietwucher einsetzen und sieht sich damit auf einer Seite mit Landesregierungen, Städten und Gemeinden. Dass Pläne für einen Mietendeckel und Gemeinnützigkeit Investoren abschrecken könnten, ist für sie zweitrangig, denn der Markt, sagt sie, funktioniere nicht richtig.
WELT: Der Erfolg der Linken bei der Bundestagswahl hat viele überrascht. In Berlin wurde die Partei stärkste Kraft. Welche Rolle hat die Lage am Wohnungsmarkt, haben hohe Mieten dabei gespielt?
Caren Lay: Eine sehr entscheidende. Noch bevor klar war, dass es Neuwahlen geben würde, haben wir eine Mietenkampagne gestartet und unsere Mietwucher-App vorbereitet. Dass wir als soziale Partei das Thema angehen würden, ist natürlich klar. Während der Amtszeit von Olaf Scholz sind die Mieten noch einmal drastisch gestiegen, und es hat mich schon sehr gewundert, dass kaum etwas unternommen wurde, was das Thema angeht. Weder beim Mietrecht noch beim Neubau hat wirklich etwas funktioniert. Wir haben Haustürgespräche geführt und konsequent hingehört, was die Leute interessiert. Und da waren die steigenden Mieten ganz zentral. Wir waren dann die einzige Partei, die das thematisiert hat. Es wundert einen fast schon, dass die anderen Parteien das so tief gehängt haben.
WELT: Wie sind die Zugriffszahlen beim Mietenwucherrechner?
Lay: Mehr als 98.600 Haushalte in acht Städten haben das Tool bereits genutzt. Bei einer klaren Mehrheit liegt die Miete mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, und in mindestens 3550 Fällen wurde eine Verdachtsmeldung an die örtliche Wohnungsbehörde geschickt.
WELT: Wegen Verdachts auf Mietwucher?
Lay: Liegt die Miete mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, besteht Verdacht auf eine Ordnungswidrigkeit. Bei mehr als 50 Prozent könnte eine Straftat laut Wirtschaftsstrafgesetzbuch vorliegen.
WELT: Die Rechtsprechung ist hier nicht eindeutig. Es muss klar sein, dass der Vermieter die schwächere Position eines Mieters ausgenutzt hat.
Lay: Das gelingt selten, und deshalb sind wir dafür, dass dieser sogenannte Wucherparagraf scharf gestellt wird. Übrigens nicht nur wir, es gab auch Entscheidungsvorlagen aus verschiedenen Bundesländern dazu im Bundesrat – interessanterweise zuerst aus Bayern, dann auch aus dem rot-grün regierten Hamburg und aus dem schwarz-grün regierten Nordrhein-Westfalen. Was ich damit sagen will: Auf Landesebene wird das Problem überhöhter Mieten erkannt. In Frankfurt am Main gibt es eine Stelle im Wohnungsamt, die gegen überhöhte Mieten ordnungsrechtlich vorgeht. Wir wollen jetzt Druck machen, dass auch andere Kommunen solche Prüfstellen einrichten.
WELT: Sie wollen Vermieter zu Straftatverdächtigen machen.
Lay: Wie gesagt, selbst die CDU-Bauministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, ist dafür, dass Wuchermieten juristisch besser verfolgt werden können. Im Grunde genommen geht es doch um etwas Ähnliches wie eine Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitung oder Falschparken. Wir haben ein 100-Tage-Programm für diese Legislatur, wo wir auf parlamentarischer Ebene das Thema weiter anstoßen wollen. Das Feedback, das uns erreicht, zeigt aber auch, dass die Menschen es schätzen, dass wir nicht nur Gesetzesvorlagen einbringen, sondern beim Thema Mietwucher oder Heizkosten echte Hilfe anbieten.
WELT: Ein zentraler Punkt in Ihrem Programm ist ein bundesweiter Mietendeckel oder Mietenstopp. Ohne konkreten Anlass würden damit Preise begrenzt – ein kaum begründbarer Eingriff in Eigentumsrechte und Vertragsfreiheit. In Berlin ist ein Mietendeckel schon einmal verfassungsrechtlich gescheitert.
Lay: In Berlin ist der Mietendeckel nicht in der Sache gescheitert, also an der Frage, ob Mietpreise reguliert werden dürfen, sondern formal – weil ein Bundesland angeblich nicht zuständig sein kann für Mietrecht, obwohl auch das umstritten ist. Es hat in der Bundesrepublik übrigens schon einmal eine gesetzlich geregelte Mietpreisbegrenzung gegeben, angestoßen in den 60er-Jahren unter der Regierung Adenauer, bis Ende der 80er-Jahre.
WELT: Die Rechtsprechung hat sich seither weiterentwickelt. Deutschland hat doch bereits eines der schärfsten Mietrechte weltweit.
Lay: Wir werden unser Konzept noch einmal überarbeiten lassen, übrigens auch mit Hilfe des Republikanischen Anwaltvereins. Es läuft wohl darauf hinaus, dass wir die bereits existierenden Instrumente nutzen werden, also die Kappungsgrenzen für laufende Mietverhältnisse und die Mietpreisbremse für neue Verträge, für deutlich überhöhte Mieten, wie gesagt, das Wirtschaftsstrafrecht. Hier sind jeweils strengere Formulierungen möglich.
WELT: Also doch kein Deckel und keine Mietabsenkungen?
Lay: So würde ich das nicht sagen, denn Grundlage für die geltende Regulierung sind die Mietspiegel. Hier gilt ein Betrachtungszeitraum von sechs Jahren. Das heißt, nur die in den vergangenen sechs Jahren geschlossenen Verträge bilden die ortsübliche Vergleichsmiete. Das sorgt für eine beschleunigte Verteuerung, wie man bei aktuellen Preisspiegeln etwa in München oder Hamburg sehen kann. Wir wollen, dass alle bestehenden Verträge in die Berechnung einfließen.
WELT: Das würde auf eine pauschale Absenkung der Mieten hinauslaufen, auch in Regionen, in denen Vermieter gar keine hohen Mieten verlangen können – und das sind die meisten mittelgroßen und kleinen Orte in Deutschland.
Lay: Wir würden stärker differenzieren zwischen angespannten und ausgeglichenen Wohnungsmärkten, um verfassungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
WELT: Sie stellen Vermieter unter Generalverdacht, denn auch in gefragten Lagen gibt es Eigentümer, die fair vermieten und sich an die Regeln halten. Außerdem lassen Sie außer Acht, dass Preise für Sanierung, Verwaltung und Instandhaltung ebenfalls deutlich steigen, stärker als Durchschnittsmieten.
Lay: Das ist klar, viele Kleinvermieter halten den Laden am Laufen, gerade in ländlichen Regionen, in strukturschwachen Gebieten. Da kann ich mit Sicherheit sagen: Die würden von strengeren Preisspiegeln gar nicht getroffen. Das war übrigens auch beim Berliner Mietendeckel schon so: Nur in ein Drittel aller Mieterinnen und Mieter hätte überhaupt Anspruch auf eine Absenkung gehabt, also bei den 30 Prozent der teuersten Verträge.
WELT: Sie stellen das Prinzip der Marktwirtschaft am Wohnungsmarkt infrage.
Lay. Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware, deshalb halte ich das für legitim. Bei Gütern der Daseinsvorsorge darf der Gesetzgeber eingreifen, auch in einer freien Marktwirtschaft.
WELT: Noch einmal: Wenn rund um die preisgedeckelten Wohnungen alle anderen Preise steigen, gibt es Nebeneffekte: Vermieter hören auf zu sanieren oder instand zu setzen, Bestände verwahrlosen.
Lay: Das ist vielleicht im hochpreisigen privatwirtschaftlichen Bereich so. Bei gemeinnützig bewirtschafteten Beständen profitieren die Anbieter von Steuervergünstigungen.
WELT: Steigende Preise sind auch ein Signal für hohe Nachfrage und damit ein Auslöser für Neubau.
Lay: Grundsätzlich ja, aber wir sehen doch, was in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gebaut wurde: Zu teure Eigentums- und Mietwohnungen, die einem Großteil der Nachfragenden nichts nützen. Analysen haben gezeigt, dass nur zehn Prozent der neu gebauten Wohnungen für Durchschnittsverdiener bezahlbar waren.
WELT: Es gibt Sickereffekte – Gutverdiener ziehen in die teureren und neuen Bestände, im Marktsegment darunter werden Wohnungen frei.
Lay: Warum steigen dann die Mieten auch in diesem Segment? Der Markt, das sagen uns auch unsere Wähler, funktioniert nicht richtig. Und übrigens: Wenn die aktuell immer höheren Preise zu mehr Angebot führen sollen – wo bleibt dann genau jetzt der Bauboom?
WELT: Wollen Sie Verhältnisse wie in der DDR?
Lay: Nein, wir orientieren uns eher an der Stadt Wien. Dort gibt es einen hohen Anteil an öffentlich und genossenschaftlich bewirtschaftetem Wohnraum, bewährte Instrumente auch in der Bundesrepublik, flankiert von hoher Förderung – was übrigens auch die Bauwirtschaft fordert. Wir sind der Ansicht, dass Städte und Gemeinden stärker in die Lage versetzt werden sollten, selbst mehr zu bauen, was in Wien übrigens ebenfalls funktioniert. Der renditeorientierte Wohnungsbau, der während der Niedrigzinsphase dagegen hohe Gewinne eingefahren hat, sollte eine kleinere Rolle spielen. Und wir brauchen eine Renaissance des Genossenschaftswesens als Form des Gemeinschaftseigentums, was eine ähnliche Sicherheit bietet, wie eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim, bei gleichzeitig höherer Flexibilität. An den Wahlergebnissen sieht man doch, dass die Leute unzufrieden sind.
WELT: Von gedeckelten oder gebremsten Preisen profitieren Gutverdiener doch ganz besonders: Vermieter achten auf die Bonität der Bewerber, entscheiden sich für zahlungskräftige Neumieter, die dann Mini-Mieten zahlen, obwohl sie sich mehr leisten könnten.
Lay: Es geht um das gesamte System: Wenn die Mieten insgesamt niedriger sind, profitieren alle – und ohne eine Preisbegrenzung hätten Grundschullehrer irgendwann überhaupt keine Möglichkeit mehr, eine Wohnung in einer gefragten Stadt zu finden.
WELT: Sie können den privaten Vermieter nicht dazu zwingen, den Geringverdiener zu nehmen.
Lay: Das ist jetzt aber auch schon so. Wie gesagt, insgesamt günstigere Mieten würden die Lage beruhigen, es gäbe eine positive Auswirkung auf die Verteilung der Einkommen. Wer weniger Miete zahlt, kann privat besser vorsorgen.
WELT: Gedeckelte Mieten ändern nichts an der hohen Nachfrage, im Gegenteil. Was also ist mit Neubau?
Lay: Wir brauchen mehr Neubau, das ist klar. Auch am Stadtrand, und erst recht in Städten wie Berlin. Aber wir brauchen nicht mehr Luxuslofts. Noch einmal das Beispiel Wien: Dort entstand ein komplett neuer Stadtteil, mit einem hohen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen. Wenn übrigens Städte und Gemeinden wieder einen höheren Anteil am Wohnungsmarkt halten – was wie gesagt nichts Neues wäre – dann würde der Staat Geld sparen: Wegen der enorm steigenden Mieten muss der Staat über Wohngeld und andere Kosten der Unterkunft inzwischen mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr aufwenden. Das Geld wäre besser in neu gebauten Wohnungen angelegt.
Michael Fabricius beschäftigt sich mit Immobilienthemen und schreibt für WELT über alles, was Eigentümer, Mieter und Investoren betrifft.