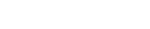Was andere für schönes Wetter halten, immer wieder Sonne,
ist für Henrik Tendler vor allem eines: ein immer größer werdendes Problem. „Gerade
dieses Jahr ist es besonders trocken. Wir bauen Mais und Getreide an, und das
Getreide vertrocknet gerade auf dem Halm. Dabei ist jetzt die Zeit, in der es
Wasser braucht“, sagt der Landwirt aus Sachsen-Anhalt.
Sein Betrieb befindet sich in der Altmark. Dort sei der Boden eher leicht – das Wasser hält sich nicht lange darin. Zwar gebe es Regen, manchmal sogar genug, aber
nicht zur richtigen Zeit. Der Regen verteile sich ungünstig. „Viel im Winter, wenig
im Frühjahr zum Beispiel“, sagt Tendler. Für dieses Jahr ist er zumindest beim Getreide
pessimistisch. „Die Erlöse aus der Ernte werden voraussichtlich nicht mal die
variablen Kosten decken, wie Pflanzenschutzmittel oder Dünger“, sorgt er sich.
Der Landwirt mit seinen 80 Hektar ist nicht allein. In manchen Regionen fiel seit Jahresanfang nur ein
Bruchteil des Regens, der normalerweise die Frühjahresmonate prägt. Schleswig-Holstein,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, aber auch Teile von Bayern sind im
Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums dunkelrot gefärbt. Schon fallen Vergleiche
mit dem Dürrejahr 2018.
Werden wieder staatliche Hilfen nötig?
Damals richtete die monatelange Trockenheit national so
verheerende Schäden an, dass die Bundesregierung die zuständigen Länder mit
Dürrehilfen für die Landwirte unterstützte – fast 300 Millionen Euro flossen an Betriebe.
Ob das dieses Jahr auch notwendig wird, ist noch völlig offen: „Lediglich wenn
das Schadensereignis von der Bundesregierung als Ereignis von nationalem Ausmaß
eingestuft wird, kann der Bund finanzielle Hilfe für den Schadensausgleich und
den Wiederaufbau im Bereich Forst- und Landwirtschaft leisten. Dazu müssen die Gesamtumstände
bewertet werden“ heißt es vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Solche Hilfen
unterliegen auch dem europäischen Beihilferecht, das macht es zusätzlich
kompliziert und langwierig.
Noch wird darüber nicht diskutiert. Hier und dort
regnet es genug, auf schweren, besonders lehmhaltigen Böden hält sich der wenige Niederschlag besser
als auf leichten, sandigen Böden. Viele Landwirte haben sich zudem auf die Situation eingestellt und bauen etwa andere und unterschiedliche Feldfrüchte an.
Auch Henrik Tendler macht das so. „Wir haben nach Alternativen gesucht und bauen
deswegen seit Kurzem Kichererbsen, Buchweizen und Sonnenblumen an“, erzählt der Landwirt. Die
Sonnenblumen könnten jetzt Wasser brauchen, die Kichererbsen allerdings
gedeihen gut. „Kichererbsen haben wir auf 14 Hektar, die brauchen wenig Wasser
und kommen mit der derzeitigen Trockenheit zurecht“, sagt er. Tendler gehört
damit zum sogenannten Kichererbsenring: 16 Betriebe in Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen bauen hier unter wissenschaftlicher
Aufsicht Kichererbsen an, um herauszufinden, welche Sorten unter welchen
Bedingungen in einem trockeneren Deutschland wachsen würden. Mit einem solchen
Vorstoß war man schon bei einer anderen Hülsenfrucht erfolgreich – die Sojabohne,
beliebt als Viehfutter und als Lebensmittel. 2011 wurden in Deutschland auf 5.000
Hektar Sojabohnen angebaut –
mittlerweile sind es über 35.000 Hektar.