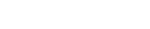Tilmann Lahme hat einen bedeutenden Schriftsteller entdeckt, etwas spät zwar (150 Jahre nach dessen Geburt), aber es handelt sich um eine jener Entdeckungen, wie sie weiß Gott nicht alle Tage zu vermelden sind. Dieser Schriftsteller heißt Thomas Mann. Von dem hat man allerdings schon gehört.
Wenn von einer „Entdeckung“ die Rede ist, dann nicht im Sinne des Aufstöberns, auch keiner nun ganz und gar neuen Beleuchtung. Lahme hat es vielmehr gewagt und fertiggebracht, Thomas Mann unter dem Vergrößerungsglas von zu seiner Frühzeit, um 1900, gängigen sexualwissenschaftlichen, sagen wir: nicht Erkenntnissen, aber doch starken und ihn deswegen auch beeinflussenden Meinungen zu betrachten und dem Bild, das die Nachwelt von ihm hat und das ja keineswegs eindimensional ist, noch einmal Konturen zu verleihen, wie sie in dieser Klarheit und Schärfe nicht mehr zu erwarten waren.
Ein klitzekleines Wort
„Thomas Mann. Ein Leben“ (dtv Verlag) kommt im Titel so unprätentiös daher, wie es dann auch geschrieben ist. Schon ein klitzekleines Wort nimmt für den Wälzer von fast 600 Seiten ein, ein für sich genommen nicht weiter aufregendes Pronomen: „Dann kommt noch dieser Klaus, und Golo versteht sofort. Der Vater tanzt so auffällig um den jungen Gast herum, dass Golo kaum noch sein Zimmer verlassen will. Die Mutter schreibt Erika, ihr Bruder sei geradezu ,von Eifersucht umdüstert’.“ Jeder andere Biograph hätte diesen Klaus – Klaus Heuser, eine von Thomas Manns Schwärmereien, nicht Sohn Klaus, aber in den war er zeitweise bekanntlich auch verliebt – mit einer Mischung aus Spitzfingrig- und Betulichkeit, letztlich mit falscher Schonung durch den Hintereingang kommen lassen.
Lahme dagegen ist es nicht um Einfühlung zu tun; er zeigt mit dem distanzierenden „dieser“ ein Gespür für das Befremdliche, das darin liegt, dass Thomas Mann einen achtzehnjährigen Düsseldorfer, für den er während eines Sylt-Urlaubs 1927 aschenbachhaft entbrannt war, in sein Haus eingeladen hat, in dem er ja keine sturmfreie Bude hatte.
In der bisherigen Biographik war es, sofern sie diesen Dingen überhaupt genauer nachgegangen ist, üblich, solche der Öffentlichkeit ja längst bekannten Figuren und Bewandtnisse mit einer der Harmonisierung des Gesamtbildes dienenden, aber, wie Lahme nun zeigt: falschen Diskretion zu behandeln.
Ein Indiskretionsmonster
Spätestens seit den „Buddenbrooks“ – das wird in Lübeck Anfang Juni sicherlich wieder zur Sprache kommen – ist Thomas Mann als Indiskretionsmonster berüchtigt, das die Menschen um sich herum mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit (und freilich höchstem literarischen Ertrag) studiert und ausbeutet. Lahme, und damit kommen wir zu einer seiner ganz wesentlichen Leistungen, führt vor, dass Thomas Mann Rücksichten vor allem auf sich selbst nahm. Das wusste man teilweise schon. Was man, zumindest so, noch nicht wusste, ist, dass „die Forschung“, wenn man die Befassung mit ihm summarisch so nennen darf, sich diese Rücksichten (auf ihn!) hier und da zu eigen gemacht hat.

Dies geschah zu einem doppelten Preis: Zum einen beschwichtigten die Lebensbeschreibungen Thomas Manns sexuelle Disposition, die ganz eindeutig homosexuell, kein bisschen bi- war und die man sich mit Lahme nun gar nicht mehr prekär genug vorstellen kann; wie sie eben auch nicht in den Blick bekamen oder nahmen, in welchem Kummer Thomas Mann wegen der Notwendigkeit einer letztlich auf Triebunterdrückung hinauslaufenden Balance lebenslang ausharrte. Zum anderen wurde eine, wie sich nun herausstellt: absolut zentrale, weit über das bisher bekannte Ausmaß hinaus prägende Jugendfreundschaft in teils geschichtsklitternder, teils ehrabschneiderischer Art und Weise tradiert: Das ist der Fall Otto Grautoff. Zu ihm später.
Der berühmte Sontag-Besuch
Aber wie sind Erkenntnisse, die eine breitere Aufmerksamkeit beanspruchen dürfen, heute überhaupt noch möglich? Man kann ja nicht gerade sagen, die Thomas-Mann-Forschung hätte bisher auf der faulen Haut gelegen. Jedoch kamen und kommen da immer ganz verschiedene Mentalitäten oder Prägungen ins Spiel. Diese haben mit dazu beigetragen, dass Thomas Manns Homosexualität lange als vorübergehendes, irgendwann, man wusste auch nicht so genau, wie, überwundenes oder doch eingehegtes Problem behandelt oder diplomatisch geglättet und literarisch nobilitiert, in den Gesamtlebenszusammenhang eingebettet wurde, dabei außer Acht lassend, wie besessen Thomas Mann davon tatsächlich war.

Arbeiten, die sich seit den Neunzigerjahren näher oder sogar ausschließlich damit beschäftigten, solche von Karl Werner Böhm, Gerhard Härle oder Heinrich Detering, blieb deswegen nur ein Außenseiterstatus, wenn sie nicht sowieso bekämpft wurden. Erst Michael Maar, der Literatur- gerne als Detektiv- oder Kriminalgeschichte betreibt, ist Thomas Manns Hang zur Geheimniskrämerei in Leben und Werk unterm Beifall auch von Teilen der community energisch zu Leibe gerückt, auch wenn dabei manches spekulativ bleibt.
Die Öffnung der Tagebücher, die 1975 nach Ablauf der von Thomas Mann selbst verhängten Frist von 20 Jahren nach seinem Tod möglich wurde, weckte allenthalben die Erwartung, nun erfahre man endlich die ganze Wahrheit über ihn, auch Unschönes oder Intimstes. In gewisser Weise war diese neue Offenheit ein Problem; denn sie war eine nur teilweise, mit der man sich aber zufriedengab in dem Glauben, sie wäre eine komplette. Lahme findet zum Schluss klare Worte zur von entsprechenden Rücksichten gesteuerten Veröffentlichungspolitik.
Allerprivateste Rücksichten – auf wen?
Peter de Mendelssohn, der Thomas Manns Leben sowieso als eine Art Heiligenlegende betrachtete und die Tagebuch-Herausgeberschaft von dem 1977 plötzlich gestorbenen Sohn Michael übernommen hatte, versprach den „ganzen“ Thomas Mann, von dem man nun alles drucken werde, bis auf ganz wenige Stellen vielleicht, aus „allerprivatesten Rücksichten“, die Dritte beträfen. Inge Jens, die wiederum von de Mendelssohn übernommen hatte, hielt es nicht viel anders, tat aber so, als wäre sie weniger „gschamig“.
Lahme stellt fest, dass diese Rücksichten vor allem Thomas Mann selbst galten. Auf einer Doppelseite präsentiert er, was alles in den zehn Bänden zu 1918 bis 1921 sowie 1933 bis 1955 unterschlagen wurde: jede Menge Notate über den „sexuellen Kummer“. Einzelheiten kann man sich denken. Sie sind im Prinzip nicht neu; wohl aber in dieser Häufung und Deutlichkeit, die es immerhin erlauben, sie nicht nur als schlüpfrige Kuriosa am Rande, sondern als Ausdruck eines zentralen, ganz existentiellen Problems zu betrachten.

Hier kommt Otto Grautoff ins Spiel, der bei Lahme gewissermaßen zum heimlichen Helden wird. Die Forschung hatte diesen Jugendfreund zwar eine „Schlüsselfigur“ genannt, aber genauso behandelt wie Thomas Mann selbst auch. Bei Erscheinen des ebenfalls von de Mendelssohn herausgegebenen, ebenfalls in für Thomas Mann günstiger Weise zensierten Briefwechsels mit Grautoff bezeichnete Marcel Reich-Ranicki in dieser Zeitung den Adressaten, wie seither auch manch anderer Interpret, als „subalternes Faktotum“ – und provozierte damit einen Leserbrief, in dem Grautoff als nachmaligem Kunsthistoriker und Kulturvermittler, der für das deutsch-französische Verhältnis nach dem Ersten Weltkrieg viel Gutes bewirkt hat, Genüge getan wurde.
Die konträre Empfindung
Lahme bringt zwei bisher unbekannte Briefe an Grautoff von Juni/Juli 1896, also noch lange vor den „Buddenbrooks“, in denen Thomas Mann sich mit ihm offen über eine gemeinsame, von Lahme eindeutig belegte Lektüre austauscht, die es in sich hat, aus der die beiden jedoch unterschiedliche Konsequenzen ziehen: Richard von Krafft-Ebings „Psychopathia sexualis“ und von Albert Moll „Die konträre Sexualempfindung“. Man lese das im einzelnen bei Lahme nach. Hier mag folgendes genügen: Beide Leser machen sich die in den damals sehr populären Studien vertretenen Auffassungen von Homosexualität als „krankhaft“, als „Perversion“, als etwas zu Überwindendes und notabene auch Überwindbares zu eigen. Denn es gebe etwas dagegen: eine diätetische Lebensweise, keine Selbstbefriedigung und natürlich auch keine Männerkontakte, dazu Hypnose.
Thomas Mann an Grautoff, September 1896: „Ich denke an mein Leiden, an das Problem meines Leidens. Woran leide ich? An der Wissenschaft … wird sie mich denn zu Grunde richten? Woran leide ich? An der Geschlechtlichkeit … wird sie mich denn zu Grunde richten? Wie komme ich von der Wissenschaft los? Durch die Religion? Wie komme ich von der Geschlechtlichkeit los? Durch Reisessen?“ Jetzt begreift man auch, was mit dieser „Wissenschaft“ gemeint ist: die vermeintlichen Erkenntnisse der beiden Sachbuchautoren, die es nahelegen, sich als „Stiefkinder der Natur“ zu betrachten. Lahme zieht von hier aus eine direkte Linie zu Hans Castorp, der also aus noch ganz anderen Gründen als den bisher bekannten ein „Sorgenkind des Lebens ist“.

Die Erschütterung durch die Lektüre, die Lahme für beide Freunde geltend macht, nötigt sie dazu, ihre Lebensführung danach auszurichten, inklusive Heirat, mit welcher der Anschein des „nie wieder was von gehört“ erweckt werden soll. Thomas Mann, der von Nietzsches asketischen Idealen schon hat läuten hören, unterzieht sich, anders als Grautoff, aber keiner Therapie und betrachtet das alles mit seinen berüchtigten „litterarischen“ Augen, mit einem gleichsam objektivierenden, sich aus psychologischer Entlarvung speisenden „Galgenhumor“. Jene „Schlafkuren“ mit leichten Mädchen, die Heinrich gegenüber seinem Jugendfreund Ludwig Ewers dem jüngeren Bruder so roh empfahl, kamen für ihn a priori nicht in Frage, bald, nach gewissen italienischen Erfahrungen vor 1900, die Lahme durchaus für möglich hält, auch mit Jungen oder Männern nicht (mehr).
Der Mann, der nicht lieben durfte
So wurde aus Thomas der Mann, der nicht lieben durfte, vor allem nicht in einem Sinne, der über die tonio-kröger-hafte Bürgerliebe hinausgegangen wäre. Die Zuschreibungen, mit denen er jede erotische Begierde versah, sind bekannt und wesentlicher Teil seiner Werkmotivik („Heimsuchung“, „Dämon“); Lahme erweitert das Repertoire noch. Aus diesem Konflikt – und was für einer es war, zeigt Lahme bis ins Letzte – entstand seine Kunst. Im Grunde lief darauf schon Klaus Happrechts Monumental-Biographie von 1995 hinaus, über die sich Gustav Seibt seinerzeit in dieser Zeitung lustig gemacht hat, zu Unrecht, wie man nun leider feststellen muss. „Leider“ gilt natürlich auch für den Verfasser des „Doktor Faustus“, der bei Lahme zu schlecht wegkommt.
In diesem „Endwerk“ ist die Geheimniskrämerei, zu der Thomas Mann neigte, auf geradezu unheimliche Weise auf die Spitze getrieben. Dabei kann sich die Galerie der von ihm Geliebten sehen lassen; in alphabetischer Reihenfolge: Paul Ehrenberg, Klaus Heuser, Oswald Kirsten, Armin Martens, Williram Timpe und Franz Westermeier. Lahme nimmt sie scharf in den Blick und konzentriert sich doch auf Grautoff, der nicht geliebt wurde, aber gewissermaßen das Medium ist, durch das am meisten und am zuverlässigsten über Thomas Manns Frühzeit zu erfahren ist.

Thomas Manns Verhältnis zu seinem, wie er selbst spürt: unentbehrlichen Gesprächs- und Briefpartner ist herablassend, opportunistisch, rücksichtslos und illoyal. Die Forschung, auch das kein Ruhmesblatt, hat daraus die Berechtigung abgeleitet, Grautoff als minderwertiges Anhängsel zu präsentieren, das nur deshalb interessant ist, weil Thomas Mann sich mit ihm abgab. Lahme rückt manche Irrtümer, die sich bis in die jüngst erschienen Essays III der GKFA erhalten haben, gerade.
Eine Art Vernichtungspolitik
Mustergültig ist am Umgang mit Grautoff zu sehen, wie konsequent und radikal Thomas Mann die Entstehung seines gewaltigen Ruhms inklusive eines im Sinne höherer Stimmigkeit immer weiter geglätteten Lebenswegs von Anfang an steuerte. Das ist an sich keine Neuigkeit. Doch Lahme demonstriert, wie gründlich dies durch eine Art von Vernichtungspolitik geschah: kaum ein Brief ohne die manchmal geradezu panisch wirkende Aufforderung, ihn sofort nach Lektüre verschwinden zu lassen. Dauernd sitzt ihm die Angst im Nacken, auch nur einer könne in fremde Hände geraten; noch 1950, da ist Grautoff längst tot, quält ihn diese Vorstellung.

Thomas Mann hat wichtige Zeugnisse aus seiner Frühzeit beseitigt. Dazu gehören vor allem die Briefe an und von Grautoff. Allzu viel Glanz gab es damals noch nicht, nur reichlich Qual, die er mit Grautoff (wenig) brüderlich teilte. Auch seine sämtlichen Tagebücher bis 1933 hat er, mit Ausnahme derer von 1918 bis 1921, verbrannt. Gerade unter dem Aspekt seiner „sexuellen Invertiertheit“, seiner „conträren Sexualität“, wie er sie im Einklang mit der damaligen „Wissenschaft“ nannte, wären sie vermutlich sehr aufschlussreich. Mit der in dieser Tiefenschärfe bisher nicht vorgenommenen Durchleuchtung des Grautoff-Komplexes rettet Lahme,was (noch) zu retten ist.
Die Hunde im Souterrain
Aber ist das denn alles wirklich so wichtig? Nun, bei Nietzsche hatte Thomas Mann gelesen, dass die Sexualität bis in die letzten Winkel der Geistigkeit hineinwirkt, und sich das gut gemerkt, wie er auch dank Freud Bescheid wusste und am eigenen Leib erfuhr, welche Qualen es ihm bereitete, Nietzsches „Hunde im Souterrain“ dauerhaft an die Kette zu legen. Diese Schlagworte sind seit sehr langer Zeit Gemeingut der Thomas-Mann-Forschung, der eine detaillierte Ausbreitung solcher Sachverhalte aber immer ein Dorn im Auge war und die sie deswegen lieber geistesgeschichtlich einrahmte.
Der Rezensent war in den Achtzigerjahren Zeuge, als Eckhard Heftrich, der gegenüber den Hunden im Souterrain nun wirklich nicht blind war, in einer Münsteraner Vorlesung der Frage einer Studentin mit der Bemerkung auswich: „Wir sind hier nicht zum Richter bestimmt.“ Hermann Kurzke, Gott hab ihn selig, von dem die nach allgemeinem Dafürhalten „gerechteste“ Biographie stammt, bemühte sich um nachvollziehende Einfühlung und wollte im Leben des Hochverehrten „Mädchen“ sehen, wo keine Mädchen waren.
Manchen Vorbehalt gegen eine Überbetonung der Sexualität versteht man ja auch. Aber Lahme rückt den ganzen Komplex in überzeugender, mit glänzenden Einsichten und absolut vernünftigen Wertungen gespickter Engführung von Leben und Werk auf eine angenehm handfeste Art und Weise ins rechte Licht und legt eine Lebensbeschreibung in klar-pointiertem Stil vor, mit sarkastischem Humor und doch nicht ohne echte Anteilnahme, auch für die „Nebenfiguren“, die ja alle außer Thomas Mann selbst waren und die von der Forschung gleichfalls immer ein wenig herablassend betrachtet oder beiseite gedrängt wurden. Was Otto Grautoff betrifft, dem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, eines von Lahmes Hauptverdiensten ist, so hat Thomas Mann ihn gebraucht, um sich von ihm gleichsam wie von einem Beckenrand abzustoßen, hinein in ein Leben voller literarischer Phantasie und sexueller Unterdrückung.
Tilmann Lahmes Buch wird noch von vielen Generationen gelesen werden, genau, wie es Samuel Lublinski den „Buddenbrooks“ prophezeit hatte. Sagen wir so: Der Rezensent, der in der großen weiten Welt der einschlägigen Literatur auch ein wenig herumgekommen ist, hat noch kein Buch über Thomas Mann mit solcher Verblüffung und im übrigen auch so gerne gelesen wie dieses.