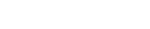Im deutschen Kulturbetrieb breitet sich derzeit perplexe Ruhe aus, gemessen an den selbstgewissen und kampfeslustigen Zeiten noch vor einem Jahr. Nach dem Regierungswechsel warten die meisten Strategen erst einmal ab, bevor es wieder ins Grundsätzliche geht, und genau dorthin wird es ganz sicher wieder gehen. Denn die Unsicherheiten, denen sich der Betrieb ausgesetzt sieht, der private, der öffentlich-rechtliche und der direkt subventionierte, haben weniger mit Marktlage oder Haushaltskürzungen zu tun als mit Stimmung und Richtung. Das sind an sich schon Wörter fürs Unsichere, und wo die Kultur nicht ganz genau weiß, was sie soll oder darf, sucht sie für gewöhnlich Klärung in Kämpfen, die sich ums Ganze drehen, also im Prinzip um sie selbst.
Mit Ausnahme Berlins, wo nur noch die Müllabfuhr zufriedenstellend funktioniert, droht kein Kahlschlag. Es muss also etwas mit Orientierungslosigkeit zu tun haben, wenn die Berufung des neuen Kulturbeauftragten der Bundesregierung eine unverhältnismäßige Aufmerksamkeit erzeugt, zumal es sich dabei um einen Mann von unklarem Wesen handelt, über dessen Charaktereigenschaften unterschiedliche Ansichten im Umlauf sind und von dem kaum bekannt ist, was er weiß und was er politisch will – und ob überhaupt. Die Projektionen sind freigelassen, die Reflexe des Widerstands und des Angriffs bleiben intakt: Kommt die Zensurdebatte zurück, mit neuen Antisemitismusklauseln? Der progressive Teil des Betriebs zieht sich bereits in die Festung zurück, entschlossen, seine Erzählungen bis aufs Blut zu verteidigen. Die andere Seite träumt davon, endlich Helmut Kohls „geistig-moralische Wende“ nachzuholen.
Es ist mehr im Gange als bloß Überdruss an einer Kultur der Belehrung und der moralischen Einschüchterung, mehr als ein vibe shift. Der reale Kern betrifft die Neuverteilung von Finanzmitteln, neu besetzte Gremien, die andere Personalpolitiken verfolgen, es betrifft Verlagerungen der öffentlichen Aufmerksamkeit, mithin Fragen der Legitimation von kulturellen Einrichtungen. Der Bereich der Gedenk- und Vertriebenenkultur wandert in ein als Heimatministerium sich verstehendes Innenressort, wo er früher mal verantwortet wurde, bevor Gerhard Schröder den Kulturstaatsminister erfand. So gehen Weichenstellungen. Die nationale Orgel ist bespielbar. Andererseits ist der Kulturbetrieb so eingerichtet, dass er Durchregieren jeder Art verhindern kann. Es liegt an den Einrichtungen, ihr Publikum, ihren Teil der Gesellschaft zu erreichen, kein Kommissar wird sie daran hindern.
Etwas jedoch ist in der Tat neu und betrifft den größeren Rahmen, in dem Kultur wahrgenommen wird: Diese Bundesregierung trat im Zeichen der Verteidigung parlamentarischer Normalverhältnisse an, als „die letzte Patrone der Demokratie“, wie Markus Söder so schön sagte. Auch wer Söders Wortwahl belächelt, muss zugeben, dass sie die Sache nicht vollständig verfehlt. Ein Aroma von Ernsthaftigkeit geht von der Bundespolitik aus, sie bemüht sich, den Parteienkampf nicht auf offener Bühne auszutragen und den Konsens der Demokraten auch zu zeigen.
Davon kann die Kultur nicht absehen. Sie vermag zwar gesellschaftliche Stimmungslagen zu variieren, aus eigener Kraft aber nicht zu erzeugen. Selbst in ihren vernagelten Zonen wird sich herumsprechen, dass Konservatismus und Liberalismus demokratisch sind und kulturfähig. Man kann dem Staatsminister aus vielerlei Gründen die Eignung absprechen, aber nicht, weil er aus einem unliebsamen Teil des Meinungsspektrums kommt. Wie denn Kulturleute auch von ihrer Kulturpolitik fordern können, dass sie den Apparat pflegt, nicht jedoch, dass sie auch noch die Gesinnung der dort Tätigen repräsentiert.
Es wirkt sonderbar, wenn Kulturprogressive weiterhin so tun, als stünden sie ganz allein fürs Demokratische, bekämpften die AfD, wo sie Konservative und Liberale mitmeinen. Ebenso bleibt der Wille, alles auf national zu drehen, ein irrer trumpistischer Wunsch. Viele werden versuchen, an der alten Frontstellung festzuhalten. Aber auch neue Arrangements werden sich ergeben, mit einem Publikum, das sich weiterentwickelt. Das Interessante spielt sich in der Kultur ab, nicht im Kanzleramt.