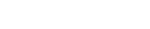Es brodelt, es köchelt, es rumort – man nenne es, wie man möchte – Harmonie jedenfalls klingt anders: Noch nicht einmal einen Monat ist die neue Koalition im Amt, da bahnt sich ein erster Konflikt an. Auslöser ist das Lieferkettengesetz und Friedrich Merz‚ Antrittsbesuch bei der EU-Kommission in Brüssel vor anderthalb Wochen. Da sagte Merz: „Die dauerhafte Lösung des Problems muss darin bestehen, diese
Richtlinie schlicht aufzuheben, so wie wir das mit dem deutschen
Lieferkettengesetz in naher Zukunft auch machen werden.“ Nicht abmildern, nicht anpassen – nein, aufheben. Die Kettensäge also.
Nun war zu erwarten, dass der neue Bundeskanzler das Thema auf die Agenda setzen wird. Der Bürokratieabbau war schließlich eines der Wahlkampfthemen der Union. Und als eines der größten „Bürokratiemonster“ hat sie eben das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz identifiziert, das seit Anfang 2023 gilt – und die europäische Richtlinie, die 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Beide verpflichten Unternehmen, ihre Lieferketten auf Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechte zu durchleuchten.
Die Klarheit und Tragweite von Merz‘ Ansage überraschte dann aber doch. Das machte auch SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil deutlich – drei Tage später bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel: „Insgesamt waren wir uns einig, das Lieferkettengesetz ist wichtig“, sagte Klingbeil. Man werde daran festhalten.
Die Einigkeit, mit der die neue Bundesregierung auf EU-Ebene auftreten wollte: dahin. Seither mehren sich in der SPD die Stimmen der Entrüstung, während Merz aus Reihen der Union Rückendeckung erhält. Man könnte auch sagen: Die
Fronten verhärten sich. Und das Lieferkettengesetz droht zum ersten
Streitthema der neuen Koalition zu werden.
SPD offen für Dialog – mit klaren Grenzen
„Natürlich können wir darüber reden, jedes Gesetz praktikabler zu gestalten“, sagt Udo Bullmann, hessischer SPD-Abgeordneter im EU-Parlament und dort Mitglied in den Ausschüssen Internationale Entwicklung und Internationaler Handel. „Aber so eine Politik nach Trumpscher Art, bei der man dem anderen etwas vor den Latz knallt, wird es mit uns nicht geben.“ Da müsse die SPD als Koalitionspartnerin Rückgrat beweisen, fordert Bullmann gegenüber ZEIT ONLINE. Schließlich gehe es darum, welche Werte Deutschland als wirtschaftliches Kernland in Europa vertreten wolle.
Und auch René Repasi, Delegationsvorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, äußert zum Wochenstart Kritik. „Wir haben in den Koalitionsverhandlungen über mehrere Tage darüber diskutiert“, sagt Repasi. „Die Passage im Koalitionsvertrag ist eindeutig: Das europäische Gesetz bleibt.“
Für die SPD ist das Lieferkettengesetz ein Anliegen mit Gewicht. Sie hatte es in der letzten Koalition mit der Union unter Angela Merkel maßgeblich erarbeitet und durchgesetzt. Es sollte Vorbild für andere EU-Staaten sein. Ende 2021 verabschiedete der Bundestag das Gesetz, die SPD nannte es einen „historischen Schritt gegen Ausbeutung„. Dass es seit 2024 auch auf EU-Ebene so eine Richtlinie gibt, nannte die SPD einen „riesigen Erfolg“. Doch schon zum Ende der Ampelkoalition hin wurde die Kritik von Unternehmensverbänden am deutschen Gesetz immer stärker: Die Berichtspflichten seien zu umfangreich, sie lähmten vor allem mittelständische Unternehmen – ein Bremsklotz für die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft, so die Argumentation.
Schon Olaf Scholz stellte deshalb in Aussicht, das Lieferkettengesetz zu überdenken. Union und SPD einigten sich schließlich im Koalitionsvertrag auf einen Kompromiss: Das nationale Gesetz solle abgeschafft und durch eines
ersetzt werden, das die europäische Richtlinie „bürokratiearm und
vollzugsfreundlich umsetzt“. Alle Sanktionsmechanismen des deutschen Gesetzes sind aktuell deshalb ausgesetzt. Doch nie war die Rede davon, die EU-Richtlinie gänzlich abzuschaffen.