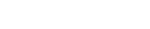Manchester United hat in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Absturz erlitten. Sportlich erfolglos, wirtschaftlich ausgeblutet. Jetzt soll ein Europapokal-Triumph mal wieder ein bisschen Ruhm bescheren. Vor allem aber einen Platz in der Champions League.
Im Old Trafford ist die große Geschichte lebendig. Auf der Längstribüne zu Ehren von Sir Bobby Charlton, dem vor anderthalb Jahren verstorbenen Gentleman des englischen Fußballs. Wie auf der anderen Stadiongeraden, benannt nach Sir Alex Ferguson. Dort erzählen lange Banderolen zwischen Unterrang und Oberrang vom Ruhm einer Ära. „Der unmögliche Traum“ steht auf einer, „Sir Alex, 26 Jahre“ auf der nächsten, „machte ihn möglich“ auf der dritten. Dazu alle Trophäen, die Manchester United unter Ferguson gewonnen hat: nicht weniger als 38 Pokale.
Anders als Charltons Heldentaten fanden die von Ferguson nicht überwiegend im Schwarz-Weiß-Fernsehen statt, sie sind gerade mal eine gute Dekade her. Umso brutaler nimmt sich der Absturz von Britanniens populärstem Fußballklub aus. Seit der Demission des knorrigen Schotten 2013 hat United keine Meisterschaft mehr gewonnen, kein Champions-League-Halbfinale mehr gespielt, nie mehr stabil guten Fußball gezeigt. Aktuell liegt der einstige Serienmeister in der Premier League auf dem fünftletzten Platz, hat mit 18 Spielen so viele verloren wie seit der Abstiegssaison 1973/1974 nicht mehr und muss nur deshalb nicht um den Klassenverbleib zittern, weil Englands hochpreisiger Investorenbetrieb mittlerweile einer geschlossenen Gesellschaft nahe kommt – die je drei Aufsteiger können wegen ihrer finanziellen Nachteile nicht mithalten.
Doch selbst United kann seinen Misserfolg nicht mehr in üblichem Maße amortisieren. Seit dem Wendejahr 2013 erwirtschafte es beim Im- und Export von Spielern ein Minus von 1,4 Milliarden Euro – europaweit unerreicht, selbst von Scheichklubs wie Stadtrivale City oder Paris Saint-Germain. Der Schuldenstand beträgt knapp 900 Millionen Euro, dazu kommen gut 400 Millionen Euro an noch nicht geleisteten Zahlungen für Transfers. Ein rabiates Sparprogramm sorgte für Schlagzeilen. Neben hunderten Arbeitsplätzen fielen ihm auch die Mitarbeiterkantine und ein mit kolportiert 2,5 Millionen Euro jährlich dotierter Botschaftervertrag Fergusons zum Opfer. Selbst eine Mäuseplage in den engen Gängen des charmanten und stimmungsvollen, aber eben auch schon 115 Jahre alten Old Trafford gab es zu konstatieren.
Die Fans ertragen die dürftige Performance meist bewundernswert, sie animieren ohne den Snobismus derjenigen, die schon viel Besseres gesehen haben. Die 74.310 Plätze des Old Trafford sind immer besetzt, notfalls mit Touristen. Rund 750 Millionen Sympathisanten soll United weltweit haben, eine Folge der schillernden Teams um Eric Cantona, David Beckham oder Cristiano Ronaldo, die mit der Globalisierungswelle des europäischen Fußballs koinzidierten. Und diese Dreiviertelmilliarde hat nun plötzlich ein Rendezvous mit dem Trost.
Wie sich die Glazers an United bereicherten
Am Mittwoch bestreitet United das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur, Tabellennachbar und Leidensgenosse aus Englands abgestürztem Adel. Vermeintlich geht es in Bilbao nur um den Titel in der zweiten Liga des Kontinents. Doch der Gewinner erhält auch einen Startplatz in der Champions League. Und der könnte vieles ändern. Nach der jüngsten Reform der Champagnerliga kann er für einen Klub aus einem der großen TV-Märkte mindestens 100 Millionen Euro wert sein. Die würden etwa helfen, die kühne Vision eines Stadionneubaus näher rücken zu lassen. Danach soll neben dem Old Trafford zu Kosten von rund zweieinhalb Milliarden Euro eine Arena mit 100.000 Besucherplätzen entstehen. Es wäre das mit Abstand größte Stadion Englands. „Wir müssen mutig sein“, sekundierte der alte Ferguson die Pläne.
Die Fans freilich meinen andere Dinge, wenn sie ritualhaft fordern: „We want our club back“ – wir wollen unseren Klub zurück. Diesen Frühling jährte sich zum 20. Mal die Übernahme des Vereins durch die amerikanische Investorenfamilie Glazer. Die Presse würdigte das Jubiläum mit Schaudern. Die „toxischste Klubübernahme der Geschichte“ beschrieb der rechtskonservative „Daily Telegraph“, die „Ursünde des englischen Fußballs“ der linksliberale „Guardian“. In einer fremdfinanzierten Übernahme bürdeten die am Fußball uninteressierten Glazers dem Verein damals die Kosten des Manövers auf: Plötzlich hatte das zuvor profitable United eine Milliarde Euro Schulden.
Schon im Mai 2005 gründeten Fans den Parallelverein FC United, der seither im Amateurbereich die alten Werte hochzuhalten versucht. Bald begannen außerdem Grün und Gold zu Protestinsignien zu werden: In solchen Trikots spielte der Eisenbahnerklub Newton Heath, Vorläufer von Manchester United im 19. Jahrhundert. Die Farben sind bis heute unter den Fans allgegenwärtig, die Proteste unter dem Slogan „Love United, Hate Glazer“ – oder dem Akronym LUHG – auch, 2021 während der Pandemie erzwang ein überraschender Stadionüberfall sogar eine Spielabsage. Doch auch ein Übernahmeversuch von Bankern und Anwälten unter dem verschwörerischen Namen „Red Knights“ scheiterte. Die Glazers sind immer noch da.
Wie sie sich an dem Verein bereichert haben, lässt sich auch dadurch erahnen, dass sie durch den Verkauf von 25 Prozent der Anteile an Weihnachten 2023 rund 1,55 Milliarden Euro einstrichen; in britischen Pfund ist die Summe fast das Doppelte jenes Gesamtkaufpreises von 2005, den sie nicht selbst bezahlten. Der Erwerber, Jim Ratcliffe, Gründer und Chef der Ineos-Gruppe, stockte mit Kapitalerweiterungen von weiteren rund 280 Millionen Euro mittlerweile auf knapp 29 Prozent auf und ließ sich die Hoheit über das Tagesgeschäft zusichern. Das hat vorerst Aspekte eines Eigentors: Denn jetzt ist er es, den der Zorn für Sparmaßnahmen, Entlassungen und – trotz der bescheidenen Darbietungen – immer weiter erhöhte Eintrittspreise trifft.
Sportlich setzt Ratcliffe alles auf die Karte seines Trainerwechsels vom vergangenen November. Kurz nach einer Vertragsverlängerung feuerte er den Niederländer Erik ten Hag und ersetzte ihn durch den hochgehandelten Portugiesen Rúben Amorim. Das Manöver kostete mit der Ablöse an dessen Klub Sporting Lissabon und der Abfindung für ten Hag rund 25 Millionen Euro. Von Ertrag ist bisher wenig zu sehen.
Dem neuen Trainer wurde weitgehend freie Hand beim Personal gegeben, von der er auch reichlich Gebrauch machte. In Marcus Rashford sortierte er Uniteds größtes Talent des vergangenen Jahrzehnts aus, in dem Brasilianer Antony einen der teuersten Einkäufe der Klubgeschichte. Beiden hielt er eine unprofessionelle Einstellung vor. Doch an ihren Leihstationen Aston Villa bzw. Betis Sevilla zeigen sie nun teils exzellente Leistungen – und scheinen damit die Interpretation nahezulegen, dass weniger sie das Problem waren als ein leistungshemmendes Ambiente in Manchester.
Amorims Realismus
Tatsächlich ist das Old Trafford zu einem Friedhof für Stars verkommen. Allein Bruno Fernandes, Amorims Landsmann und Kapitän der Mannschaft, hält sein Niveau; der Mittelfeldmann scheint fast zu gut für den Rest zu spielen, dem es schwerfällt, seinen Ideen und seiner Dynamik zu folgen. Wie lange sich Fernandes das noch antun will, ist eine andere Frage. Auch sie wird wohl nicht zuletzt am Mittwoch in Bilbao verhandelt.
Grund zu Zuversicht bietet allenfalls der Blick in die Geschichte. Auch die legendäre Ferguson-Ära kam nur langsam ins Rollen und bedurfte erst einer Generalüberholung von Kader und Sitten. Nachdem er ebenfalls in einem November (1986) angefangen hatte, machte sich der Schotte an die Arbeit, eine verruchte Elf zu disziplinieren. „Ich manage einen Fußball-, keinen Trinkerklub“, proklamierte er. Es dauerte dreieinhalb Jahre bis zum ersten Titel, einem englischen Pokalsieg.
Im Vergleich dazu würde sich Amorim mit einem gewonnenen Finale geradezu auf die Expressspur bewegen. Vorher brauchte es allerdings das Wunder eines 5:4-Siegs nach 2:4-Rückstand über Olympique Lyon in der Verlängerung des Viertelfinalrückspiels – und viel Schiedsrichterglück. Ein Platzverweis für Lyons Corentin Tolisso kurz vor Schluss der regulären Spielzeit war ebenso zweifelhaft wie jener für Bilbaos Dani Vivian, der im Hinspiel früh Uniteds Weg durch das Halbfinale planierte.
Der Klub vermittelt nach außen den Eindruck, ähnlich unbedingt zum Trainer stehen zu wollen, wie es einst die Vereinsführung mit Ferguson tat. Die größte Kritik an ihm kommt bisher von Amorim selbst. „Peinlich“ nannte er die Ergebnisse diese Saison schon und suggerierte, soweit handele es sich bei ihm um den schlechtesten Trainer der Klubgeschichte. Zuletzt erklärte der 40-Jährige, wenn nach dem Sommer nicht schnell signifikante Verbesserungen in Spiel, Teamkultur und Mentalität festzustellen seien, wolle er Platz für andere machen. United habe die „Angst vor dem Verlieren“ verloren, „und das ist das Gefährlichste, was einem großen Klub passieren kann“. Mit Auftritten wie bisher, so Amorim, „sollten wir nicht in der Champions League spielen“.
Ehrliche Worte, immerhin – und Amorim garnierte sie dieser Tage auch noch mit einer konkreten Abbitte: Der Portugiese erklärte, für 30 Klubmitarbeiter und deren Familien die Kosten für den Trip nach Bilbao zu übernehmen.