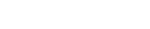Bis zum Beginn der architektonischen Wegwerfkultur im zwanzigsten Jahrhundert gehörte die Wiederverwendung älterer Bauglieder für Neubauten zur täglichen Materialbeschaffung. Mal ging es um kulturelle Bedeutungsträger wie bei den Venezianern, die im eroberten Konstantinopel 1204 so viel Baukunst klauten, dass Markusdom und Piazzetta zur weltgrößten Spoliensammlung wurden, mal brauchten die Pariser bloß Material, als sie nach 1789 die Abbruchsteine der verhassten Bastille im neuen Pont de la Concorde verbauten.
Wie sehr diese Einsparung von Rohstoffen, Arbeit und Müll in Vergessenheit geraten ist, zeigt das Ärgernis, dass heute in Deutschland jährlich zweihundert Millionen Tonnen Bau- und Abrissabfälle entstehen, die mehr als die Hälfte des gesamten Müllaufkommens ausmachen. Gegen diese Verschwendung wendet sich der von dem Berliner Architekten und Verleger Philipp Meuser und dem grünen Baupolitiker Kassem Taler Saleh herausgegebene Lagebericht „Baupolitik im Wandel“, der acht Fachautoren zu breit diskutierten Themen befragt: Bauen im Bestand, Reduce, Re-Use, Reparieren statt Abreißen. Zwar haben die meisten Architekten diese Appelle verstanden. Aber weil die deutsche Bauwirtschaft eine Bruttowertschöpfung hat, die der gesamten Auto- und Verkehrsindustrie entspricht, gelingt der bauliche Kurswechsel nur so langsam wie die Mobilitätswende auf den Straßen.

Die in Berlin lehrende Architektin Elisabeth Broermann von der Initiative „Architects for Future“ zeigt eingangs, wie schwer es ist, Umbau gegen Abriss durchzusetzen. Anstelle der auf Jahrhunderte angelegten Lebensdauer vormoderner Gebäude werden Neubauten heute nach spätestens vierzig Jahren Nutzung entsorgt. Denn aktuelle Baugesetze und Vorschriften sind laut Broermann für neue Gebäude standardisiert, wogegen Um-, An- und Ausbauten im Bestand stets Sondergenehmigungen brauchen und häufig an hohen technischen und energetischen Neubaustandards scheitern. Besser sei ein „Bestandsschutz“, damit Umbauten nur den Schall-, Brand- und Wärmedämmauflagen des Altbaujahres unterliegen. Das sei angesichts der in den alten Gemäuern gespeicherten „grauen Energie“ ressourcensparender als alle technischen Neuerungen. Vor jedem Abriss sollten erst die Sanierungsfähigkeit und notfalls die Wiederverwendbarkeit der Bauteile geprüft werden. Nötig sei die Umwandlung der Bauordnung in eine „Umbauordnung“.
Downcycling ist nicht die Lösung
Kein Verständnis zeigen Broermann und ihre Ko-Autoren für herkömmliche Recycling-Ideen. Dabei handele es sich meist um Downcycling, weil die Trümmer nur noch als Schotter im Straßenbau oder als Stoff für Brennöfen dienen. Zumindest sei hier eine „Kaskadennutzung“ hilfreicher, wenn etwa Bauholz für Möbel, Fußböden, Holzverbundplatten und erst ganz zuletzt für die Verbrennung genutzt werde. Doch solch sinnvoller Resteverwertung steht das penible Abfallwirtschaftsgesetz entgegen.
Der Klimatechniker und Unternehmensberater Emanuel Heisenberg aus Würzburg beschreibt, wie drei Viertel aller Gebäude in der EU, die energetisch ineffizient sind, ertüchtigt werden können. „Beim derzeitigen Tempo würde die Dekarbonisierung des Gebäudesektors Jahrhunderte dauern“, zitiert der Autor eine Warnung des Europäischen Parlaments, aber weiß zugleich Abhilfe. Anstelle einer unbezahlbaren handwerklichen Nachrüstung brauche es eine serielle Vorfertigung von Fassadenelementen („in Holzrahmenbauweise mit Zellulose“) für etwa acht Millionen sanierungsreife Wohnungen in Deutschland. Damit ließen sich die Reparaturkosten halbieren.
Neue Wohnformen
Der Herausgeber Philipp Meuser hält an der Architekturmoderne fest und plädiert für neue Kleinstwohnungen für ein bis zwei Bewohner in Kompaktbauten mit minimierten Außenflächen und effizienten Rastergrundrissen. Anders als die Stapelware der Großsiedlungen nach 1960 sollen diese Unterkünfte künftig perfekt erschlossene Rohlinge für den Selbstausbau in Eigenleistung sein, was die Hälfte der Baukosten einspare. Damit die bundesweite Genehmigung solcher Typenentwürfe nicht länger an den Landesgesetzen scheitert, brauche es eine Bundesbauordnung.

Wie sich „unsichtbarer Wohnraum“ ohne Neubau gewinnen lässt, zeigt der Wohnungsökonom Daniel Fuhrhop mit dem Modell des „Homesharing“ in Form des Zusammenwohnens mehrerer Generationen. Wenn Eltern nach dem Auszug ihrer Kinder ihre übergroßen Wohnungen an jüngere Leute vermieten, die entweder dafür zahlen oder aber im Haushalt helfen, ließen sich in diesen sogenannten „leeren Nestern“ jährlich hunderttausend neue Wohnverhältnisse schaffen, was einem Drittel der derzeitigen Neubauten entspreche. Die einen brauchen Platz, so Fuhrhop, die anderen Gesellschaft oder Hilfe, was aber nur funktioniert, wenn die Leute zueinander passen. Dafür gibt es in Deutschland mittlerweile 36 Vermittlungsstellen, die die Parteien zusammenführen. Karlsruhe bietet sogar Mietgarantien für ängstliche Eigentümer, die aus Furcht vor Mietnomaden ihre Zimmer oder ganze Wohnungen lieber leer stehen lassen. Was für Deutsche noch utopisch klingt, ist in Belgien längst Alltag. Dort bringt die Organisation „1Toit2Ages“ jährlich 400 Wohnpaare aus Alten und Jungen zusammen, und Frankreich hat sogar ein Gesetz, welches das Wohnen mit mehreren Generationen erfolgreich fördert.
Dass auch Schönheit und Wohlgefallen zu einer dauerhaften Architektur gehören, begründet die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Andrea Gebhard: „Stadtviertel und Häuser, die die Menschen schätzen, werden eher gepflegt und weiterentwickelt.“ Deshalb sei das Reparieren und Umnutzen wichtiger als das Bauen und Recyceln. Doch das können laut Gebhard die technologiezentrierten Nachhaltigkeitsroutinen der Bauwirtschaft nicht erreichen, die vor allem der eigenen Umsatzsteigerung dienen. Man wünscht sich, dass Politik und Industrie diese Forderungen nach einer überfälligen Bauwende beherzigen. Damit werden zwar keine Markusdome oder Seine-Brücken mehr entstehen, wohl aber vertrauenerweckende Häuser, die länger als eine Generation halten.
„Baupolitik im Wandel“. Architektonische, soziale und klimapolitische Positionen. Hrsgg. von Philipp Meuser und Kassem Taher Saleh. DOM publishers, Berlin 2025. 160 S., Abb., geb., 28,– €.