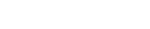Zum Trainer des Jahres wird nach dieser Saison ausnahmsweise nicht Christian Streich ernannt werden. In den circa 97 Jahren, in denen er Teams des SC Freiburg gecoacht hat, hat Streich ja kaum weniger Lorbeeren und Auszeichnungen empfangen als der FC Bayern, dankenswerterweise ohne dessen vermessenen Anspruch zu erheben, dass ihm sämtliche Titel von Natur aus zustehen (siehe Slogan der jüngsten Meisterschaftszeremonie: „Die Schale ist wieder dahoam“). Streich ist nicht nur regelmäßig als herausragender Trainer geehrt worden, er war auch unter anderem „Mann des Jahres“ (2017) und „Persönlichkeit des Jahres“ (2024). Den „Markgräfler Gutedelpreis“ (2014) hat er ebenfalls erhalten und mit ihm ein 225-Liter-Eichenfass des guten Weines.
Diesen hochgradig verdienten Mann zu beerben, das war eine Aufgabe, die auf ihre besondere Art sicher nicht kleiner war als die von Arne Slot als Nachfolger Jürgen Klopps beim FC Liverpool. Es ist daher nicht so verwunderlich, dass Streichs junger Nachfahre Julian Schuster am finalen Bundesliga-Spieltag als großer Verlierer vom Platz ging. Schuster und der Sportclub verfehlten ihr Ziel – das ist die harte Wahrheit an diesem Wochenende. Man werde „Wege finden, das akzeptieren zu können“, musste Schuster einräumen.
Den Ausweg hat der 35 Jahre alte Coach ohne geistliche Beihilfe schon im nächsten Augenblick entdeckt, indem er mit aller Berechtigung aussagte, „nichts verloren“, sondern „Tolles erreicht“ zu haben. Die Freiburger haben zwar durch die 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt die Anwartschaft auf die erste Champions-League-Teilnahme eingebüßt – was eine große Enttäuschung bedeutete. Aber sie haben im Jahr eins n. S. wieder die Europa League erreicht. In Wahrheit hört der Sportclub also auch mit dem Trainer-Neuling Schuster nicht auf, erfolgreich zu sein und ein landes-, wenn nicht weltweites Vorbild für gute Vereinsführung zu sein.
Letzteres wird inzwischen auch Eintracht Frankfurt nachgesagt, vor nicht langer Zeit eine berüchtigte Adresse der Szene. Nach Frankfurt führt eine sehr relevante Spur auf der Suche nach dem Trainer des Jahres. Dino Toppmöller, 44, war nach der Vorsaison in der Vereinsführung alles andere als unumstritten. Er ließ das Chef-Bewusstsein vermissen, das zu seinem Job gehört, wirkte unsicher und unentschlossen. Manager Markus Krösche handelte und engagierte zwei neue Trainer.
Toppmöller hat in Frankfurt schon einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, Kovac sollte in Dortmund einen bekommen
Doch Xaver Zembrod und Jan Fießer sollten Toppmöller nicht ersetzen, sondern unterstützen, und geschadet hat das Manöver mit den neuen Assistenten offenbar nicht: Statt Freiburg ist es nun die Eintracht, die – für sie zum zweiten Mal – in die Champions League einzieht. Dass Toppmöller soeben einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, ist allenfalls zur Hälfte eine Gefälligkeit des Vereins. Zur anderen Hälfte ist es ein Gefallen, den Toppmöller dem Verein tut. Seine Bilanz als Ausbilder, der Spieler zu entwickeln versteht, macht ihn attraktiv. Allein die Gelassenheit, mit der der kooperative Trainer die Verkäufe der Torjäger Randal Kolo Muani und Omar Marmoush mittrug, macht ihn zum Anwärter auf eine Auszeichnung jenseits der Apfelwein-Folklore.
Als weiterer Anwärter auf Preiswürdigkeit tritt ein Mann hervor, der ebenfalls in Frankfurt seine schönste Trainerzeit hatte. In München, Monaco und Wolfsburg hatte Niko Kovac, 53, anschließend einige schöne, aber auch viele schwere Stunden erlebt. Auch in Dortmund begann seine Zeit als Krisenmanager mühsam, auf Dauer aber ließ er die Mannschaft des BVB wie ein Team aussehen, das straff, effektiv und zielsicher geführt wird. Dafür muss man Kovac noch nicht zum neuen Pep Guardiola ernennen – für eine Daueranstellung beim bisher noch zögerlichen BVB hat er sich allemal empfohlen.