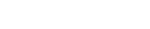Über den richtigen Umgang der EU mit Russland diskutieren die Gäste bei „Caren Miosga“. CDU-Politiker Norbert Röttgen fordert, mit neuen Sanktionen weiter Druck auf Putin auszuüben. Journalist Heribert Prantl befremdet es, Russland durch Androhungen „die Pistole auf den Tisch“ zu legen.
Norbert Röttgen ahnte es voraus. „Ich halte es für ausgeschlossen, dass es zu einem direkten Gespräch“ zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj komme, hatte er am Mittwoch im Deutschlandfunk prognostizierte. Und tatsächlich trafen anstelle der beiden Präsidenten schließlich Delegierte der zweiten Reihe in Istanbul aufeinander. Dafür lobte er die „europäische Entschlossenheit“, die sich in den letzten Tagen gezeigt hatte.
Zur Frage „Putin versetzt Selenskyj – und Europa schaut zu?“ trat der Außenpolitiker der CDU am Sonntag auch bei Caren Miosga auf. Als weitere Gäste begrüßte sie den Diplomaten Rüdiger von Fritsch, die Sicherheitsexpertin Claudia Major und die Journalisten Heribert Prantl und Vassili Golod.
„Der Krieg ist das Mittel der Wahl von Putin“, sagte Norbert Röttgen im Hinblick auf die Bemühungen in der Türkei sowie die jüngsten Drohnenangriffe auf die Ukraine. „Er hat eine historische Idee. Er akzeptiert nicht, dass Russland ein Land ist wie andere, sondern er sieht das russische Selbstverständnis darin, ein Imperium zu sein, das herrscht.“ Durch den Druck, den die Europäer und Donald Trump auf ihn ausgeübt hatten, habe Putin zwar reagieren müssen, doch das Gesprächsangebot in Istanbul sei letztlich nur ein „Ausweichmanöver“ gewesen. „Es war niemals der Wille vorhanden, wirklich zu verhandeln.“
Im Prinzip seien die diplomatischen Anstrengungen gut, urteilte Claudia Major, doch zwischen Russland und den westlichen Staaten bestünden völlig verschiedene Verständnisse von Diplomatie. Dem Westen gehe es darum, Gesprächsbereitschaft zu zeigen und Kompromisse zu schließen, um den Krieg zu beenden. Aus russischer Sicht sei Diplomatie hingegen ein anderes Mittel, um den Krieg zu gewinnen. Es gebe zwar Gespräche über Gefangenenaustausche oder das Getreideabkommen, doch weder in den vergangenen Wochen noch in den letzten drei Jahren habe Russland Kompromissbereitschaft gezeigt.
Ernüchtert zeigte sich auch der zugeschaltete Vassili Golod, der mit Vertretern der ukrainischen Delegation gesprochen hatte. Die Russen hätten auf einen „Handshake“ verzichtet, wären bei Maximalforderungen geblieben, in der Tonlage sachlich aufgetreten, inhaltlich aber „sehr, sehr scharf“. So solle der russische Delegationsführer Wladimir Medinski in die Runde gesagt haben, „dass einige am ukrainischen Tisch Angehörige verloren hätten in dem Angriffskrieg. Und wenn man sich nicht an die russischen Forderungen halten würde, dann würden es noch mehr Angehörige werden, die sterben.“
Besagter Medinski sei weder ein diplomatischer Unterhändler noch ein politisches Schwergewicht, erklärte Rüdiger von Fritsch. Der Anführer der russischen Delegation in Istanbul sei vielmehr einer der „schlimmen Ideologen und Geschichtsfälscher der russischen Führung“. Er klittere die Historie und legitimiere damit die Herrschaft von Putin. Diesem wiederum fehle die Bereitschaft, den Krieg in Verhandlungen zu beenden. „Wir müssen uns klarmachen, dass eine Lösung nicht in unserer Logik, sondern in Putins Logik funktioniert“, schilderte der Diplomat, „und seine Logik ist nicht die eines abstrakten Harmoniebedürfnisses“.
Heribert Prantl tat sich schwer mit den Positionen seiner Mitdiskutanten. Die jüngsten Bemühungen in der Türkei bezeichnete er als „Einstieg in den Einstieg“ in Verhandlungen. „Ich weiß, dass man es probieren muss, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt“, insistierte der ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Als Mediator befremde ihn die Verhandlungsweise, „die Pistole auf den Tisch“ zu legen, indem mit neuen Sanktionen gedroht werde. Stattdessen schlug er vor, die Repressalien als „Verhandlungsmasse“ zu benutzen und dabei in Aussicht zu stellen, diese abzuschaffen.
US-Sanktionen könnten laut Röttgen Eindruck auf Putin machen
Ob Putin damit zum Einlenken zu bewegen wäre? „Ich weiß es ja nicht – Sie wissen es auch nicht!“, erwiderte ein sichtlich gereizter Prantl. „Doch, ich habe es fünf Jahre in Moskau probiert“, antwortete von Fritsch. Gegenüber Putin und Lawrow habe er erfolglos appelliert, eine Lösung im Dialog zu suchen. Warum solle sich der russische Präsident darauf einlassen, wenn es nicht seiner Logik entspreche? „Ich kann in den Kopf von Putin nicht reinschauen. Sie können es vielleicht, weil Sie ihm gegenübersaßen“, hielt Prantl dagegen. Historisch betrachtet seien Friedensverhandlungen nun mal „mühsam“ und „zäh“.
Für Röttgen stelle sich in der Debatte eine zentrale Frage. „Was könnte ihn bewegen, von dem Krieg als Mittel der Politik, das er gewählt hat, Abstand zu nehmen?“ Er plädierte dafür, mithilfe der kommenden Sanktionspakete weiteren Druck auf Putin auszuüben, eine bessere Unterstützung der Ukraine zu gewährleisten und zugleich den US-Präsidenten „an ihrer, an unserer Seite zu halten“. Wenn Trump zum Ergebnis komme, Putin tanze ihm „auf der Nase herum“ und es käme zu amerikanischen Sanktionen, dann wäre das der Erfolg, den die europäische Diplomatie anstrebe und der auf Putin Eindruck machen würde.
Ob sich der Kreml über die Sanktionen nicht scheckig lache?, fragte Caren Miosga. „Nein, durchaus nicht“, erwiderte von Fritsch. „Der Effekt ist ungeheuer.“ Russland habe eine zivile Rezession, eine Inflation von zehn Prozent, eine Lebensmittelinflation von mehr als zwölf Prozent. Zudem weise die Zentralbank einen Leitzins von 21 Prozent auf, was die Investitionen zum Erliegen gebracht habe. Und Zweidrittel der russischen Reserven seien bereits aufgebraucht. „Er spielt das Spiel: Wer hält länger die Luft an?“, erläuterte der frühere Botschafter. „Das ist eine Frage der Zeit. Das hält auch Wladimir Putin nicht ewig durch.“
Dominik Lippe berichtet für WELT regelmäßig über die abendlichen Polit-Talkshows. Der studierte Biologe ist Absolvent der Axel Springer FreeTech Academy.