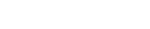Die dreimonatige Verschiebung der von Präsident Trump angekündigten massiven Zollerhöhungen hatten zumindest vorübergehend zu einer Entspannung an den Märkten geführt, teilweise auch durch die Hoffnung, dass diese Entscheidung signalisiert, dass die auch für die USA drohenden Kollateralschäden zunehmend gesehen werden und Kompromissbereitschaft fördern. Ob diese Hoffnung trägt, ist fraglich. Die aktuellen Reaktionen auf Trumps neuerliche Ankündigungen zeigen die Verunsicherung nur zu deutlich
Die deutschen Unternehmen waren unter dem Eindruck des amerikanischen Wahlkampfes schon zu Beginn der neuen Amtsperiode von Donald Trump durchaus darauf gefasst, dass er seinen Ankündigungen Taten folgen lassen würde. Bei einer Befragung von mittleren und größeren Unternehmen gaben 92 Prozent zu Protokoll, dass sie mit höheren Zöllen auf europäische Produkte rechnen, 78 Prozent auch mit zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China.
Anders als zu Beginn seiner ersten Amtsperiode waren diesmal auch Hoffnungen auf Mäßigung wesentlich geringer: 2016 gingen lediglich sieben Prozent der Unternehmensleitungen davon aus, dass Trump seine Ankündigungen während seines Wahlkampfes nach Amtsantritt im Großen und Ganzen umsetzen würde, diesmal befürchteten dies von vornherein mehr als 40 Prozent. 80 Prozent rechneten mit steigenden Risiken für die deutsche Wirtschaft, 68 Prozent mit erheblichen Auswirkungen der amerikanischen Zollpolitik.
Das Ausmaß der Anfang April angekündigten Erhöhungen hat trotzdem viele unvorbereitet getroffen und überrascht – nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern auch die Bevölkerung.
Die große Mehrheit ist alarmiert, weitaus mehr als während der ersten Präsidentschaft Trumps. Auch damals gab es Zollerhöhungen durch die USA, Europa und China, aber keineswegs im diesmal angekündigten Ausmaß. Damals waren nur 35 Prozent der deutschen Bevölkerung ernsthaft beunruhigt, diesmal sind es zwei Drittel.
Die Mehrheit befürchtet Auswirkungen auf den Wohlstand im Land, wenn verschärfte Zölle den Handel mit den USA belasten. Viele fühlen sich unmittelbar betroffen; so rechnen 44 Prozent der Bürger mit starken, weitere 29 Prozent zumindest mit begrenzten Auswirkungen des Handelskonflikts auf ihre eigene wirtschaftliche Lage.
Krisen schärfen den Realitätssinn und sensibilisieren für Risiken und Abhängigkeiten. So wie den meisten erst durch den Ukrainekrieg bewusst wurde, wie abhängig Deutschland von russischen Energielieferungen war, und wie schlecht gerüstet, um die eigene Sicherheit zu verteidigen, schärfen auch die gewachsenen geopolitischen Spannungen und die Zollpolitik der amerikanischen Regierung das Bewusstsein für ökonomische Risiken und die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Freihandel und Globalisierung.
So ist die überwältigende Mehrheit überzeugt, dass die weitere wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands vom Verlauf internationaler Konflikte abhängt.
Auch die amerikanische Politik und die Entwicklung von Freihandelsschranken und insbesondere Zöllen werden zu wesentlichen Einflussfaktoren gezählt – weitaus mehr als die Entscheidungen auf europäischer Ebene. Während die Mehrheit überzeugt ist, dass die amerikanische Politik einen gravierenden Einfluss auf die ökonomischen Perspektiven Deutschlands hat, messen nur 37 Prozent den Entscheidungen der Europäischen Kommission eine vergleichbare Bedeutung bei.
Der Wert von freiem Handel wird unter dem Eindruck der Ereignisse signifikant höher bewertet als früher. Schon die spontane Reaktion auf den Schlüsselbegriff Freihandel zeigt das veränderte gesellschaftliche Klima. Vor einem Jahrzehnt reagierten 43 Prozent der Bevölkerung auf den bloßen Begriff positiv, 38 Prozent mit Antipathie. Heute überwiegen positive Reaktionen im Verhältnis 75 zu 15.
Zwar war der überwältigenden Mehrheit immer bewusst, dass möglichst wenig Handelsschranken für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wichtig sind. Die Bedeutung von Freihandel wird heute jedoch noch wesentlich höher veranschlagt als zuvor: Der Anteil der Bevölkerung, der Freihandel für außerordentlich wichtig hält, ist seit 2017 von 38 auf 55 Prozent angestiegen, weitere 36 Prozent halten ihn für wichtig; der Kreis, der Freihandel nur geringe Bedeutung zuschreibt, macht gerade noch vier Prozent der Bevölkerung aus.
Trotz der großen Bedeutung, die freien Handelsbeziehungen zugeschrieben wird, hatte die Bevölkerung in der Vergangenheit durchaus eine ambivalente Haltung zu ihren effektiven Nutzen.
Noch vor zwei Jahren waren lediglich 45 Prozent überzeugt, dass ein weitgehender Verzicht auf Handelsschranken überwiegend Vorteile mit sich bringt; jeder Vierte ging davon aus, dass sich Vorteile und Nachteile ausgleichen, zehn Prozent sahen sogar überwiegend Nachteile. Diese Einschätzung hat sich unter dem Eindruck der protektionistischen Tendenzen gravierend verändert: Der Anteil der Bevölkerung, der von einer positiven Bilanz weitgehender Handelsfreiheit überzeugt ist, hat sich von 45 auf 65 Prozent erhöht.
Auch Globalisierung wird heute anders gesehen als früher. Lange Zeit überwog die Einschätzung, dass Globalisierung mehr Risiken als Chancen bietet. Vor 20 Jahren war davon die Mehrheit der Bürger überzeugt, auch vor gut zehn Jahren noch knapp jeder Zweite. Jetzt verbindet nur noch jeder Dritte Globalisierung überwiegend mit Risiken, eine knappe relative Mehrheit mit Chancen. Insbesondere die junge Generation und die höheren sozialen Schichten sehen mehr Vorteile als Nachteile der Globalisierung. Generell haben die höheren Schichten mehr Vertrauen in internationale Wirtschaftsbeziehungen.
So ist in den höheren Schichten eine Mehrheit von 69 Prozent überzeugt, dass die deutsche Wirtschaft von der Globalisierung profitiert, eine Einschätzung, die in den schwächeren Schichten nur 34 Prozent teilen.
Auch West und Ost haben teilweise einen unterschiedlichen Blick auf Globalisierung wie auch die Anhänger der verschiedenen Parteien. Die Anhänger der AfD unterscheiden sich bei vielen Fragen, die internationale Beziehungen betreffen, seien es wirtschaftliche, politische oder militärische Themen, von den Anhängern aller anderen Parteien, so auch in Bezug auf Globalisierung.
Während die Anhänger der anderen Parteien, von CDU/CSU, SPD, Grünen bis hin zur Linken, mehrheitlich überzeugt sind, dass die deutsche Wirtschaft von Globalisierung profitiert, glaubt dies nur eine Minderheit der AfD-Anhänger. Das Bedürfnis nach Abschottung prägt AfD-Anhänger in hohem Maße, weit über die Ablehnung von Zuwanderung hinaus.
Dies ist auch einer der Unterschiede zum Nationalsozialismus, der zwar auch nicht auf internationale Bündnisse und Kooperationen ausgerichtet war, aber auf Eroberung und Ausweitung des eigenen Territoriums. „Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“ – das ist kein Leitmotiv der AfD-Anhänger, sondern der weitgehende Rückzug aufs Nationale.
Dies prägt auch ihre Einstellung zu Europa und der Mitgliedschaft in der EU. Die Anhänger der AfD sind die einzige Gruppierung, die den europäischen Weg grundsätzlich infrage stellt. Die Mehrheit der Bevölkerung geht davon aus, dass es keine überzeugende Alternative zu dem europäischen Zusammenschluss gibt, und sieht bei aller Kritik im europäischen Verbund die Zukunft; unter AfD-Anhängern ist dies eine Minderheitenposition. Genauso sieht nur eine Minderheit der AfD-Anhänger die europäischen Länder als eine Wertegemeinschaft, anders als die Mehrheit der Bevölkerung.
Über die vergangenen Jahre hinweg ist die Überzeugung steil angewachsen, dass die EU ein notwendiger Zusammenschluss ist, um sich gegen Großmächte wie die USA und China behaupten zu können.
Nur unter AfD-Anhängern ist dies eine Minderheitenposition, obwohl auch sie durch die amerikanische Zollpolitik und die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China durchaus beunruhigt sind. Aber sie empfinden die europäische Ebene vor allem als Fremdbestimmung. Es gibt ein tiefes Misstrauen gegenüber europäischer Regulierung, die die überwältigende Mehrheit der AfD-Anhänger als überbordend und schädlich für Wirtschaft und Bürger kritisiert.
Auch in der Bevölkerung gibt es zwar weit verbreitet Kritik am Ausmaß und an der Gestaltung der europäischen Regulierung, aber der Wert der Mitgliedschaft wird deswegen nicht grundsätzlich infrage gestellt. Während unter AfD-Anhängern 70 Prozent überzeugt sind, dass Deutschland ohne die Mitgliedschaft in der EU wirtschaftlich besser oder zumindest genauso gut dastehen würde, glauben dies 31 Prozent der Bevölkerung.
Dies ist zwar ein beträchtlicher Anteil, der zeigt, dass die EU es nur unzureichend schafft, vom Wert des Zusammenschlusses zu überzeugen. Die Kritik an ihrer Bürokratie, am Ausmaß der Regulierung und an ihrer Schwerfälligkeit wird nur begrenzt durch die Überzeugung kompensiert, dass sie für die Bürger Vorteile bringt, ein starker Wirtschaftsraum mit hoher Lebensqualität ist und in der Weltpolitik großes Gewicht hat.
Trotzdem fällt die Bilanz der Bürger nach den zahlreichen internationalen Krisen heute ungleich positiver aus als früher. Über lange Zeit oszillierte der Anteil, der davon ausgeht, dass Deutschland ohne die Mitgliedschaft in der EU wirtschaftlich schlechter dastünde, zwischen 22 und 31 Prozent, heute glauben dies 49 Prozent.
In der Frage, wie die EU auf Zollerhöhungen durch die USA reagieren sollte, gibt es jedoch keinen Konsens. Eine relative Mehrheit von 43 Prozent der Bürger votiert für Gegenzölle, 36 Prozent dagegen für den Versuch, sich zunächst in Verhandlungen um eine Lösung zu bemühen und auf rasche Gegenmaßnahmen zu verzichten. Die Bevölkerung ist hier vorsichtiger geworden; als Trump in seiner ersten Amtszeit die Zölle erhöhte, sprachen sich 53 Prozent für Gegenmaßnahmen aus, nur jeder Vierte für Verhandlungen und Kompromisssuche.